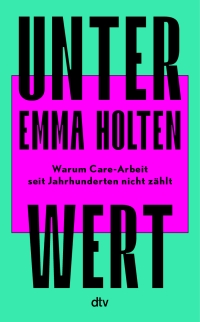
Emma Holten
Unter Wert
Warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt
München 2025 (dtv); 288 Seiten; ISBN: 978-3-423-28464-6
Seit der Aufklärung streben wir nach einer Gesellschaft, die wie eine Fabrik betrieben werden kann. Das hat Menschen, Arbeitszeiten, Beziehungen und letztlich die gesamte Zukunft in Produkte verwandelt, die mit einem Preis versehen werden können. Und dieses Prinzip, dieses Denken liegt fast jeder wichtigen politischen Entscheidung zugrunde, die unser Leben bestimmt. Emma Holten beschreibt jene Mechanismen, die dafür gesorgt haben, dass meist von Frauen geleistete Care-Arbeit politisch und wirtschaftlich niemals von Bedeutung war. Schon die frühen Wirtschaftswissenschaften verkannten den Wert von Pflegetätigkeiten. Und sie tun es bis heute. Dieses Buch führt vor, was wir verlieren werden, wenn wir daran nichts ändern.
Emma Holten, geboren 1991, ist feministische Aktivistin und Beraterin für Geschlechterpolitik. 2014 gründete sie das Projekt CONSENT über ihre eigenen Erfahrungen mit digitaler sexueller Gewalt. Seit 2019 beschäftigt sie sich mit feministischer Ökonomie. Sie ist Mitglied des Sachverständigenforums des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen und des Beratungsausschusses für Frauenrechte von Human Rights Watch. Seit 2023 berät sie die dänische Regierung im Untersuchungsausschuss zu Machtverhältnissen in Dänemark. Sie trat außerdem als Rednerin bei der UNO auf. Emma Holten lebt in Kopenhagen. 2024 veröffentlichte sie ihr erstes Buch „DEFICIT – How Feminist Economics Can Change Our World“ auf Dänisch. Es wird in den Jahren 2025 und 2026 in 10 Sprachen veröffentlicht, darunter Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Italienisch.
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
Ein Kampf um die Wahrheit • Messen heißt leben • Warum feministische Ökonomie?
KAPITEL 1: Ein mechanisches Universum
Neue Arbeiter:innen, neue Zeiten • Eine kontrollierbare Welt • Unkontrlloierbare Frauen
KAPITEL 2: Freiheit für wen?
Freiheit voneinander • Stark, unabhängig und naiv • Hobbes und Locke legen das Fundament
KAPITEL 3: Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit
Die ökonomische Mutter • Gespaltene Wirklichkeit • Rationaler Wahnsinn • Liebe und Nadeln
KAPITEL 4: Was sind wir wert?
Preiszauber • Smooth operations • Zu viel des Guten ist das Beste • Erstarrte Zukunft • Ein reiner Blick in eine unreine Welt • Preise und Realität
KAPITEL 5: Wertlose Wartung
Zunehmender Einfluss • Eine Zahl to rule them all • Ein Zombie namens BIP • Menschen müssen gepflegt werden • Die Fragmentierung der Welt • Wertlose Lösungen • Lohn für den Ego-Aufbau des Partners • Billige Kinder für den Staat
KAPITEL 6: Machtstreben
The Empire strikes back • Bettys Haushälterin • Das Recht, nicht zu verlieren • Ain't I a woman? • Eine konstruierte Frau • Zwei Tragödien
KAPITEL 7: Isolierte Optimierung
Harder, better, faster, stronger • Pilze bei der Arbeit • Abgestrafte Fürsorge • Vielfältige Maschinen • Eine kurze Zukunft
KAPITEL 8: Öffentliche Leistungen und Fehlleisungen
Die Rückkehr des Roboters • Wenn man die Kosten kennt, aber nicht den Nutzen • Was so extrem schwer ist • Was ist Wirtschaft? • Eine Unterlassungssünde • Eine neutrale Berechnung • Hochgradig unbrauchbar
KAPITEL 9: Verwaltete Wärme
Die Optimierung der Fürsorge • Eine hypothetische Person • Fürsorgeschulden • Gegenläufige Interessen • Ein umgekehrter Robin Hood • Der Kampf ums Leben
SCHLUSS
Danke, danke, danke
Anmerkungen
Nachweise
Register
Ein Kampf um die Wahrheit • Messen heißt leben • Warum feministische Ökonomie?
KAPITEL 1: Ein mechanisches Universum
Neue Arbeiter:innen, neue Zeiten • Eine kontrollierbare Welt • Unkontrlloierbare Frauen
KAPITEL 2: Freiheit für wen?
Freiheit voneinander • Stark, unabhängig und naiv • Hobbes und Locke legen das Fundament
KAPITEL 3: Geteilte Arbeit ist halbe Arbeit
Die ökonomische Mutter • Gespaltene Wirklichkeit • Rationaler Wahnsinn • Liebe und Nadeln
KAPITEL 4: Was sind wir wert?
Preiszauber • Smooth operations • Zu viel des Guten ist das Beste • Erstarrte Zukunft • Ein reiner Blick in eine unreine Welt • Preise und Realität
KAPITEL 5: Wertlose Wartung
Zunehmender Einfluss • Eine Zahl to rule them all • Ein Zombie namens BIP • Menschen müssen gepflegt werden • Die Fragmentierung der Welt • Wertlose Lösungen • Lohn für den Ego-Aufbau des Partners • Billige Kinder für den Staat
KAPITEL 6: Machtstreben
The Empire strikes back • Bettys Haushälterin • Das Recht, nicht zu verlieren • Ain't I a woman? • Eine konstruierte Frau • Zwei Tragödien
KAPITEL 7: Isolierte Optimierung
Harder, better, faster, stronger • Pilze bei der Arbeit • Abgestrafte Fürsorge • Vielfältige Maschinen • Eine kurze Zukunft
KAPITEL 8: Öffentliche Leistungen und Fehlleisungen
Die Rückkehr des Roboters • Wenn man die Kosten kennt, aber nicht den Nutzen • Was so extrem schwer ist • Was ist Wirtschaft? • Eine Unterlassungssünde • Eine neutrale Berechnung • Hochgradig unbrauchbar
KAPITEL 9: Verwaltete Wärme
Die Optimierung der Fürsorge • Eine hypothetische Person • Fürsorgeschulden • Gegenläufige Interessen • Ein umgekehrter Robin Hood • Der Kampf ums Leben
SCHLUSS
Danke, danke, danke
Anmerkungen
Nachweise
Register
LESEPROBE
Siehe
Verlagsseite
> Blick ins Buch (Seite 7-29)
Ausschnitte aus Kapitel 5: Wertlose Wartung (Seite 118 ff):
Eines Nachmittags in den 1980er-Jahren saß die Ökonomin Marilyn Waring in New York in der Bibliothek der UN und war empört. Sie hatte die letzten Wochen in einem Dokument gelesen, das beschreibt, wie das BIP berechnet wird – im System of National Accounts (SNA). Und sie konnte nicht fassen, was ihr da gerade aufgegangen war, nämlich dass die von Frauen geleistete unbezahlte Fürsorgearbeit bei der Berechnung des BIP einfach nicht berücksichtigt wurde, und zwar nirgendwo auf der Welt. Da stand, dass die Arbeit von Frauen im Haushalt „aus praktischen Gründen“ als „Freizeit“ oder „Inaktivität“ verbucht wurde – es wäre einfach zu kompliziert gewesen, das irgendwie mit einzurechnen. Im BIP wird also kein Unterschied gemacht, ob jemand eine Gruppe Kinder betreut oder ein Nickerchen macht. Beides ist unproduktiv. Waring wurde anschließend zu einer der wichtigsten Kritiker:innen des BIP. 1988 erschien ihr Buch Counting for Nothing, das auf Millionen Feminist:innen großen Eindruck machte, auf die etablierte Wirtschaft aber leider so gut wie gar keinen. Hier haben wir also den ersten Grund dafür, dass Frauen „weiter ein Verlustgeschäft für die Staatskasse“ sind: Auf der ganzen Welt verbringen Frauen mehr Zeit mit Kinderbetreuung als Männer, ohne dafür bezahlt zu werden. […]
Unbezahlte Arbeit ist im BIP vollkommen unsichtbar, weil sie nicht auf einem Markt zu einem Preis gehandelt wird. Das BIP kann uns jede Menge sagen über neue Waren, die produziert oder gekauft werden, aber so gut wie nichts über alles, was mit Reproduktion zu tun hat, oder nennen wir es: Wartung und Pflege. Nämlich das Sichkümmern um die Menschen und Waren, die es bereits gibt.
Und so trägt der Kauf von Muttermilchersatzpulver zum Wachstum bei – Stillen aber nicht. Der Kauf eines neuen Pullovers trägt zum Wachstum bei – das Flicken eines alten nicht. Einer bezahlten Arbeit nachzugehen, trägt mehr zum Wachstum bei, als die Kinder ins Bett zu bringen. Und es schafft mehr Wachstum, einen Baum zu fällen, eine Bank daraus zu machen und sie zu verkaufen, als den Baum stehen zu lassen. Alles, was keinen bezifferten Preis hat, zieht in diesen Berechnungen den Kürzeren. […]
Vertreter:innen des Ökofeminismus, die im Spannungsfeld zwischen Geschlecht, Klima und Wirtschaft arbeiten, weisen schon lange daraufhin, dass die reproduktive Arbeit zu Hause und ungenutzte natürliche Ressourcen in vielfacher Hinsicht Leidensgenossinnen sind. Sowohl die Pflege von Menschen als auch die Pflege und der Erhalt unberührter Natur sind nämlich im BIP-Kontext wertlos. Das erschwert jedes wirtschaftliche Gespräch darüber, was die Dinge eigentlich sind, bevor sie verkauft werden. […]
2013 wurde das Beratungsunternehmen Trucost gebeten, zu untersuchen, wie viel „unbepreistes Naturkapital“, also Dinge wie Wasser, Boden, saubere Luft und sämtliche natürlichen Ressourcen, von Unternehmen genutzt wird, ohne dass diese dafür bezahlen. Die Ergebnisse sind in dem Bericht „Natural Capital at Risk“ zusammengefasst. Die Unternehmen wurden gebeten, einen Plan aufzustellen für den Fall, dass saubere Luft oder sauberes Wasser plötzlich etwas kosten würden oder infolge von Naturkatastrophen schlicht nicht mehr vorhanden wären. Trucost ermittelte, dass die analysierten Sektoren zusammengenommen natürliche Ressourcen im Wert von 4,7 Billionen US-Dollar (damals etwa 3,5 Billionen Euro) nutzten, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Kein einziger der zwanzig größten ressourcenverschlingenden Sektoren würde Gewinn erwirtschaften, wenn diese reguläre Marktpreise zahlen müssten für die Ressourcen, die sie nutzen, und die Natur, die sie zerstören. Diese Sektoren generieren nur deshalb Profit, weil die Natur gratis ist. […]
Die Vorgehensweise zur Ermittlung des grünen BIP zeigte sehr deutlich auf, wo die Instrumente der etablierten Wirtschaft bei der Bestimmung von Werten an ihre Grenzen stießen. Das ging so: Man fragte die Menschen, für welchen Teil der Natur sie den höchsten Preis zu zahlen bereit wären, und das entschied darüber, welcher Teil der Natur am meisten wert war. Das nennt sich Umweltökonomie. Die Strategie geht davon aus, dass Umweltzerstörung und -verschmutzung genau wie Diskriminierung leider auch „Marktfehler“ sind. Aber wenn man mithilfe von Steuern die unterschiedlichen Ressourcen richtig auspreisen würde, könnte damit ein Markt geschaffen werden, der sich in Richtung Gleichgewicht bewegte und darum besser wäre. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie tauglich die Theorie vom Gleichgewicht ist, wenn die Existenz der Natur ein „Fehler“ ist, der korrigiert werden muss. Und man könnte befürchten, dass derartige Werteumfragen zu zehntausend niedlichen Hundewelpen und null Insekten im Jahr 2050 führen würden.
Ein Beispiel ist eine Autobahn in der Nähe der dänischen Stadt Silkeborg. 2005 befragte man dazu Anwohner:innen und handverlesene Menschen im Rest des Landes, und die Haltungen waren eindeutig: „Die Ergebnisse zeigten ausgeprägte Vorlieben bei den Befragten. Sie waren bereit, tief in die Tasche zu greifen, wenn es um den Schutz von Wäldern und Feuchtgebieten vor der neuen Autobahn ging. Der Schutz von Heidelandschaft wurde als weniger wichtig erachtet.“ Die Menschen bewerten die Natur also auf der Grundlage von vibes, nicht von Wissen. In einer Anmerkung zur Untersuchung schreiben die Ökonom:innen, dass Biolog:innen aber meinten, die Heidelandschaften seien für die Biodiversität viel wertvoller. So ein Mist aber auch!
Ich glaube, viele Biolog:innen fänden es skandalös, wenn einzelne Bereiche der Natur auf Grundlage subjektiver Meinungen bepreist würden. Der Witz ist ja, dass in der Natur alles irgendwie zusammenhängt. Heidelandschaften und Wälder sind keine voneinander getrennten Bereiche – sie sind aufeinander angewiesen.
2019 erschien in der dänischen Tageszeitung Berlingske Tidende ein Beitrag von Vibeke Lyngklip Svansø über zwei dänische Topmanager, die nichts weniger als eine Änderung des Grundgesetzes forderten: „Sauberes Wasser, Luft, Natur und Biodiversität sind, zusammen mit einem nachhaltigen Klima, ganz entscheidend lebensnotwendig und fundamental für uns alle“, sagten sie, und die Nutzung dieser Ressourcen müsse reguliert werden. Und weiter: „Das wird möglich, wenn im Grundgesetz grüne Rechte und Pflichten verankert werden.“ Sie wollten die Natur zu einem positiven Recht machen, indem Menschen und Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet würden, ihr nicht zu schaden. In einem Blogbeitrag zu diesem Vorschlag schrieb Ökonomieprofessor Christian Bjørnskov, seine „unmittelbare Reaktion darauf“ sei der Gedanke gewesen, „die beiden hätten ja wohl einen Vogel – oder zu viel Gras geraucht“. Er wies darauf hin, dass positive Rechte wie „das Recht auf Natur“ undemokratisch seien, weil man Menschen dazu zwänge, etwas zu tun, wozu sie womöglich keine Lust hätten, zum Beispiel Heidelandschaften zu bewahren. Bjørnskov erwähnte nicht, dass wir alle im Moment dazu gezwungen sind, auf einem Planeten zu leben, der behandelt wird, als wäre er nichts wert.
Die Abwesenheit von Fürsorge für die Natur ist Freiheit, die Anwesenheit von Fürsorge für die Natur ist Zwang. Die Abwesenheit von Fürsorge ist neutral und apolitisch. Die Anwesenheit von Fürsorge ist emotional und politisch. Hier zeigt sich die BIP-Leidensgenossenschaft von Natur und unbezahlter Fürsorgearbeit. Gigantische, unbepreiste Ressourcen werden in den „produktiven“ Bereich der Wirtschaft gepumpt, wo alles ausgepreist wird, und schöpfen dort enorme Werte. Leider sind die aber nicht so richtig messbar, weil die Ressourcen ja „gratis“ sind. Sie werden genutzt und genutzt und genutzt, bis sie erschöpft, ausgelaugt und tot sind. Am Ende gilt für ein totes Meer und einen Menschen mit Burn-out so ziemlich das Gleiche: Beide haben konstant zur Produktion beigetragen, ohne je wirklich die Zeit und die Ressourcen für Reproduktion gehabt zu haben – sprich: sich zu erholen.
Vielen Ökonom:innen ist das Problem mit der Hausarbeit durchaus bewusst, viele haben versucht, ihren Wert in Preise umzumünzen, wie man es mit der Natur versucht hat. Die dabei angewandte Methode war, den Mindestlohn mit der Anzahl Stunden zu multiplizieren, die Menschen bei sich zu Hause und damit verbrachten, Dinge zu tun, für die sie im Prinzip von anderen bezahlt werden könnten. 2005 berechneten zwei finnische Ökonom:innen so den Wert von unbezahlter Fürsorgearbeit. Sie kamen auf 62 Milliarden Euro. Wenn die ins finnische BIP mit eingerechnet würden, dann stiege dieses um 40 Prozent. In England wurde der Wert auf 1,24 Billionen Pfund berechnet, was etwa 60 Prozent des englischen BIP entspricht. Diese Zahlen vermitteln uns einen Eindruck vom Volumen dieser Arbeit, und das ist wichtig! Aber sie sagen nichts aus über die langfristige Wertschöpfung. Sie sind genauso tauglich wie die Sache mit der Heidelandschaft, die weniger wert ist als ein Wald. Weder das eine noch das andere macht deutlich, dass Fürsorgearbeit und die Natur nicht einfach nur ein Teil des Marktes sind, sondern seine Grundvoraussetzungen.
Das BIP (und darum auch die etablierte Wirtschaft) tendiert hingegen dazu, die Dinge durch wertdefinierendes Auspreisen auseinanderzudividieren. Die Natur wird in Produkte aufgeteilt, die Gesellschaft auf Individuen heruntergebrochen. Die Einzelteile werden mit Preisen versehen, als stünden sie in keinerlei Zusammenhang zueinander. Das erschwert es der Wirtschaftswissenschaft, die durch Beziehungen entstehenden Wertschöpfungen zu erkennen, zum Beispiel den Augenblick, in dem ein größerer Pilz einem kleineren hilft. Gemeinsam schaffen sie etwas, das keiner von beiden alleine schaffen könnte. Der kleine Pilz wäre ohne den anderen nie groß und dick geworden. Aber wenn man jedem einzeln einen Preis aufdrückt, übersieht man diesen Wert und die Arbeit, die dafür geleistet wurde. Das Gleiche gilt für Menschen, die Fürsorgearbeit leisten, bezahlt wie unbezahlt. Das ist etwas, das zwischen den Preisen passiert. Aber was noch viel schlimmer ist: Durch das BIP wird es immer so aussehen, als würden wir umso reicher, je weniger freie Natur es gibt und je weniger unbezahlte Zeit wir mit denen verbringen, die wir lieben. Was wir verlieren, ist unsichtbar, solange das, was wir verlieren, keinen Preis hat.
2024 fand ein Forschungsteam zu seiner großen Überraschung heraus, dass die Finanzkrise von 2008, durch die Millionen Menschen arbeitslos geworden waren, bei den Amerikaner:innen zu einer höheren Lebenserwartung geführt hatte. Die Wirkung war umso größer, je geringer der Bildungsgrad der Menschen war. Wie sich herausstellte, lag es an der Umwelt. Die Forscher:innen schrieben, „wirtschaftliche Aktivität“ sorge grundsätzlich für eine höhere Sterblichkeit, insbesondere, weil diese Aktivität stets eine massive Verschmutzung mit sich bringe. Die etablierte Wirtschaft, die keine Rücksicht auf die Pflege von Menschen und Planet nimmt, kann also zu einem System werden, in dem zunehmende wirtschaftliche Aktivität oder das, was wir Wachstum nennen, das Leben der Menschen verkürzt. Erst in der Krise war es plötzlich möglich, mal richtig Luft zu holen. Und erst hier wurde deutlich, dass das, womit wir unser Geld verdienen, auch das ist, was uns umbringt.
Ausschnitte aus Kapitel 5: Wertlose Wartung (Seite 118 ff):
Eines Nachmittags in den 1980er-Jahren saß die Ökonomin Marilyn Waring in New York in der Bibliothek der UN und war empört. Sie hatte die letzten Wochen in einem Dokument gelesen, das beschreibt, wie das BIP berechnet wird – im System of National Accounts (SNA). Und sie konnte nicht fassen, was ihr da gerade aufgegangen war, nämlich dass die von Frauen geleistete unbezahlte Fürsorgearbeit bei der Berechnung des BIP einfach nicht berücksichtigt wurde, und zwar nirgendwo auf der Welt. Da stand, dass die Arbeit von Frauen im Haushalt „aus praktischen Gründen“ als „Freizeit“ oder „Inaktivität“ verbucht wurde – es wäre einfach zu kompliziert gewesen, das irgendwie mit einzurechnen. Im BIP wird also kein Unterschied gemacht, ob jemand eine Gruppe Kinder betreut oder ein Nickerchen macht. Beides ist unproduktiv. Waring wurde anschließend zu einer der wichtigsten Kritiker:innen des BIP. 1988 erschien ihr Buch Counting for Nothing, das auf Millionen Feminist:innen großen Eindruck machte, auf die etablierte Wirtschaft aber leider so gut wie gar keinen. Hier haben wir also den ersten Grund dafür, dass Frauen „weiter ein Verlustgeschäft für die Staatskasse“ sind: Auf der ganzen Welt verbringen Frauen mehr Zeit mit Kinderbetreuung als Männer, ohne dafür bezahlt zu werden. […]
Unbezahlte Arbeit ist im BIP vollkommen unsichtbar, weil sie nicht auf einem Markt zu einem Preis gehandelt wird. Das BIP kann uns jede Menge sagen über neue Waren, die produziert oder gekauft werden, aber so gut wie nichts über alles, was mit Reproduktion zu tun hat, oder nennen wir es: Wartung und Pflege. Nämlich das Sichkümmern um die Menschen und Waren, die es bereits gibt.
Und so trägt der Kauf von Muttermilchersatzpulver zum Wachstum bei – Stillen aber nicht. Der Kauf eines neuen Pullovers trägt zum Wachstum bei – das Flicken eines alten nicht. Einer bezahlten Arbeit nachzugehen, trägt mehr zum Wachstum bei, als die Kinder ins Bett zu bringen. Und es schafft mehr Wachstum, einen Baum zu fällen, eine Bank daraus zu machen und sie zu verkaufen, als den Baum stehen zu lassen. Alles, was keinen bezifferten Preis hat, zieht in diesen Berechnungen den Kürzeren. […]
Vertreter:innen des Ökofeminismus, die im Spannungsfeld zwischen Geschlecht, Klima und Wirtschaft arbeiten, weisen schon lange daraufhin, dass die reproduktive Arbeit zu Hause und ungenutzte natürliche Ressourcen in vielfacher Hinsicht Leidensgenossinnen sind. Sowohl die Pflege von Menschen als auch die Pflege und der Erhalt unberührter Natur sind nämlich im BIP-Kontext wertlos. Das erschwert jedes wirtschaftliche Gespräch darüber, was die Dinge eigentlich sind, bevor sie verkauft werden. […]
2013 wurde das Beratungsunternehmen Trucost gebeten, zu untersuchen, wie viel „unbepreistes Naturkapital“, also Dinge wie Wasser, Boden, saubere Luft und sämtliche natürlichen Ressourcen, von Unternehmen genutzt wird, ohne dass diese dafür bezahlen. Die Ergebnisse sind in dem Bericht „Natural Capital at Risk“ zusammengefasst. Die Unternehmen wurden gebeten, einen Plan aufzustellen für den Fall, dass saubere Luft oder sauberes Wasser plötzlich etwas kosten würden oder infolge von Naturkatastrophen schlicht nicht mehr vorhanden wären. Trucost ermittelte, dass die analysierten Sektoren zusammengenommen natürliche Ressourcen im Wert von 4,7 Billionen US-Dollar (damals etwa 3,5 Billionen Euro) nutzten, ohne auch nur einen Cent dafür zu bezahlen. Kein einziger der zwanzig größten ressourcenverschlingenden Sektoren würde Gewinn erwirtschaften, wenn diese reguläre Marktpreise zahlen müssten für die Ressourcen, die sie nutzen, und die Natur, die sie zerstören. Diese Sektoren generieren nur deshalb Profit, weil die Natur gratis ist. […]
Die Vorgehensweise zur Ermittlung des grünen BIP zeigte sehr deutlich auf, wo die Instrumente der etablierten Wirtschaft bei der Bestimmung von Werten an ihre Grenzen stießen. Das ging so: Man fragte die Menschen, für welchen Teil der Natur sie den höchsten Preis zu zahlen bereit wären, und das entschied darüber, welcher Teil der Natur am meisten wert war. Das nennt sich Umweltökonomie. Die Strategie geht davon aus, dass Umweltzerstörung und -verschmutzung genau wie Diskriminierung leider auch „Marktfehler“ sind. Aber wenn man mithilfe von Steuern die unterschiedlichen Ressourcen richtig auspreisen würde, könnte damit ein Markt geschaffen werden, der sich in Richtung Gleichgewicht bewegte und darum besser wäre. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie tauglich die Theorie vom Gleichgewicht ist, wenn die Existenz der Natur ein „Fehler“ ist, der korrigiert werden muss. Und man könnte befürchten, dass derartige Werteumfragen zu zehntausend niedlichen Hundewelpen und null Insekten im Jahr 2050 führen würden.
Ein Beispiel ist eine Autobahn in der Nähe der dänischen Stadt Silkeborg. 2005 befragte man dazu Anwohner:innen und handverlesene Menschen im Rest des Landes, und die Haltungen waren eindeutig: „Die Ergebnisse zeigten ausgeprägte Vorlieben bei den Befragten. Sie waren bereit, tief in die Tasche zu greifen, wenn es um den Schutz von Wäldern und Feuchtgebieten vor der neuen Autobahn ging. Der Schutz von Heidelandschaft wurde als weniger wichtig erachtet.“ Die Menschen bewerten die Natur also auf der Grundlage von vibes, nicht von Wissen. In einer Anmerkung zur Untersuchung schreiben die Ökonom:innen, dass Biolog:innen aber meinten, die Heidelandschaften seien für die Biodiversität viel wertvoller. So ein Mist aber auch!
Ich glaube, viele Biolog:innen fänden es skandalös, wenn einzelne Bereiche der Natur auf Grundlage subjektiver Meinungen bepreist würden. Der Witz ist ja, dass in der Natur alles irgendwie zusammenhängt. Heidelandschaften und Wälder sind keine voneinander getrennten Bereiche – sie sind aufeinander angewiesen.
2019 erschien in der dänischen Tageszeitung Berlingske Tidende ein Beitrag von Vibeke Lyngklip Svansø über zwei dänische Topmanager, die nichts weniger als eine Änderung des Grundgesetzes forderten: „Sauberes Wasser, Luft, Natur und Biodiversität sind, zusammen mit einem nachhaltigen Klima, ganz entscheidend lebensnotwendig und fundamental für uns alle“, sagten sie, und die Nutzung dieser Ressourcen müsse reguliert werden. Und weiter: „Das wird möglich, wenn im Grundgesetz grüne Rechte und Pflichten verankert werden.“ Sie wollten die Natur zu einem positiven Recht machen, indem Menschen und Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet würden, ihr nicht zu schaden. In einem Blogbeitrag zu diesem Vorschlag schrieb Ökonomieprofessor Christian Bjørnskov, seine „unmittelbare Reaktion darauf“ sei der Gedanke gewesen, „die beiden hätten ja wohl einen Vogel – oder zu viel Gras geraucht“. Er wies darauf hin, dass positive Rechte wie „das Recht auf Natur“ undemokratisch seien, weil man Menschen dazu zwänge, etwas zu tun, wozu sie womöglich keine Lust hätten, zum Beispiel Heidelandschaften zu bewahren. Bjørnskov erwähnte nicht, dass wir alle im Moment dazu gezwungen sind, auf einem Planeten zu leben, der behandelt wird, als wäre er nichts wert.
Die Abwesenheit von Fürsorge für die Natur ist Freiheit, die Anwesenheit von Fürsorge für die Natur ist Zwang. Die Abwesenheit von Fürsorge ist neutral und apolitisch. Die Anwesenheit von Fürsorge ist emotional und politisch. Hier zeigt sich die BIP-Leidensgenossenschaft von Natur und unbezahlter Fürsorgearbeit. Gigantische, unbepreiste Ressourcen werden in den „produktiven“ Bereich der Wirtschaft gepumpt, wo alles ausgepreist wird, und schöpfen dort enorme Werte. Leider sind die aber nicht so richtig messbar, weil die Ressourcen ja „gratis“ sind. Sie werden genutzt und genutzt und genutzt, bis sie erschöpft, ausgelaugt und tot sind. Am Ende gilt für ein totes Meer und einen Menschen mit Burn-out so ziemlich das Gleiche: Beide haben konstant zur Produktion beigetragen, ohne je wirklich die Zeit und die Ressourcen für Reproduktion gehabt zu haben – sprich: sich zu erholen.
Vielen Ökonom:innen ist das Problem mit der Hausarbeit durchaus bewusst, viele haben versucht, ihren Wert in Preise umzumünzen, wie man es mit der Natur versucht hat. Die dabei angewandte Methode war, den Mindestlohn mit der Anzahl Stunden zu multiplizieren, die Menschen bei sich zu Hause und damit verbrachten, Dinge zu tun, für die sie im Prinzip von anderen bezahlt werden könnten. 2005 berechneten zwei finnische Ökonom:innen so den Wert von unbezahlter Fürsorgearbeit. Sie kamen auf 62 Milliarden Euro. Wenn die ins finnische BIP mit eingerechnet würden, dann stiege dieses um 40 Prozent. In England wurde der Wert auf 1,24 Billionen Pfund berechnet, was etwa 60 Prozent des englischen BIP entspricht. Diese Zahlen vermitteln uns einen Eindruck vom Volumen dieser Arbeit, und das ist wichtig! Aber sie sagen nichts aus über die langfristige Wertschöpfung. Sie sind genauso tauglich wie die Sache mit der Heidelandschaft, die weniger wert ist als ein Wald. Weder das eine noch das andere macht deutlich, dass Fürsorgearbeit und die Natur nicht einfach nur ein Teil des Marktes sind, sondern seine Grundvoraussetzungen.
Das BIP (und darum auch die etablierte Wirtschaft) tendiert hingegen dazu, die Dinge durch wertdefinierendes Auspreisen auseinanderzudividieren. Die Natur wird in Produkte aufgeteilt, die Gesellschaft auf Individuen heruntergebrochen. Die Einzelteile werden mit Preisen versehen, als stünden sie in keinerlei Zusammenhang zueinander. Das erschwert es der Wirtschaftswissenschaft, die durch Beziehungen entstehenden Wertschöpfungen zu erkennen, zum Beispiel den Augenblick, in dem ein größerer Pilz einem kleineren hilft. Gemeinsam schaffen sie etwas, das keiner von beiden alleine schaffen könnte. Der kleine Pilz wäre ohne den anderen nie groß und dick geworden. Aber wenn man jedem einzeln einen Preis aufdrückt, übersieht man diesen Wert und die Arbeit, die dafür geleistet wurde. Das Gleiche gilt für Menschen, die Fürsorgearbeit leisten, bezahlt wie unbezahlt. Das ist etwas, das zwischen den Preisen passiert. Aber was noch viel schlimmer ist: Durch das BIP wird es immer so aussehen, als würden wir umso reicher, je weniger freie Natur es gibt und je weniger unbezahlte Zeit wir mit denen verbringen, die wir lieben. Was wir verlieren, ist unsichtbar, solange das, was wir verlieren, keinen Preis hat.
2024 fand ein Forschungsteam zu seiner großen Überraschung heraus, dass die Finanzkrise von 2008, durch die Millionen Menschen arbeitslos geworden waren, bei den Amerikaner:innen zu einer höheren Lebenserwartung geführt hatte. Die Wirkung war umso größer, je geringer der Bildungsgrad der Menschen war. Wie sich herausstellte, lag es an der Umwelt. Die Forscher:innen schrieben, „wirtschaftliche Aktivität“ sorge grundsätzlich für eine höhere Sterblichkeit, insbesondere, weil diese Aktivität stets eine massive Verschmutzung mit sich bringe. Die etablierte Wirtschaft, die keine Rücksicht auf die Pflege von Menschen und Planet nimmt, kann also zu einem System werden, in dem zunehmende wirtschaftliche Aktivität oder das, was wir Wachstum nennen, das Leben der Menschen verkürzt. Erst in der Krise war es plötzlich möglich, mal richtig Luft zu holen. Und erst hier wurde deutlich, dass das, womit wir unser Geld verdienen, auch das ist, was uns umbringt.
SIEHE AUCH:
Emma Holten in Wikipedia (engl.)
Bernd Senf: Die blinden Flecken der Ökonomie
Wirtschaftstheorien in der Krise (2001)
Bernd Senf: Die blinden Flecken der Ökonomie
Wirtschaftstheorien in der Krise (2001)