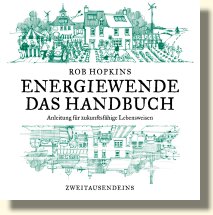|
langelieder
>
Bücherliste
> Hopkins 2008
|
|
|
|
|
|
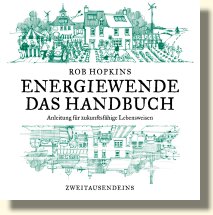
|
|
Rob
Hopkins
Energiewende. Das Handbuch
Anleitung
für zukunftsfähige Lebensweisen
Frankfurt
am Main 2008 (Zweitausendeins); 240 Seiten; ISBN-13:
978-3-86150-882-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klimawandel
und Erdölverknappung – wie können wir diese
größte wirtschaftliche, ökologische und soziale
Herausforderung unserer Gesellschaft bewältigen? Nicht mit
Atom, Kohle, Wasserstoff oder Biodiesel, sagt Rob Hopkins,
sondern mit »Kopf«, »Herz« und »Händen«:
So überschreibt der Autor die drei Hauptteile seiner
Anleitung für zukunftsfähige Lebensweisen, in der er
für eine aktive Umgestaltung unserer Städte und
Kommunen plädiert – eine Umgestaltung, die von den
Einwohnern selbst ausgeht und deren wichtigstes Ziel die
Relokalisierung von Energieversorgung, Wirtschaft und
Nahrungsmittelproduktion ist.
Das Handbuch entwirft die
Vision einer lebenswerten Zukunft, die aus dem Wissen und den
Stärken der Vergangenheit ebenso schöpft wie aus den
wissenschaftlichen Erkenntnissen unserer Zeit. Es zeigt am
Beispiel kommunaler Pilotprojekte der Transition-Towns-Bewegung
in England, wie man diese Vision verwirklichen kann.
Siehe
auch: www.transition-initiativen.de
|
|
|
Rob
Hopkins
|
|
geb.
1970, hat viele Jahre als Lehrer gearbeitet und an der
Fachhochschule im irischen Kinsale den zweijährigen
Studiengang Permakultur und ökologisches Bauen konzipiert,
der bis heute dort angeboten wird. Als er 2004 anfing, sich
intensiver mit dem Peak-Oil-Problem und dem Klimawandel zu
beschäftigen, begriff er bald, dass es keinen Sinn hat, bloß
auf neue Techniken und die Fortschreibung des Kyoto-Protokolls zu
warten. So handelte er selbst. Er gründete das
Transition-Netzwerk und die Energiewende-Initiative Transition
Town Totnes. Unter transitionculture.org
betreibt er die Website der Bewegung. Privat hegt er eine
spezielle Vorliebe für Walnussbäume.
|
|
|
Inhaltsverzeichnis
|
|
Vorwort
von Richard Heinberg
Einführung von Rob Hopkins
|
|
|
|
|
|
|
|
Erster
Teil: Der Kopf
Ölverknappung
und Klimawandel. Zwei große Probleme, die viele kleine
Lösungen erfordern
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitel
1
Ölverknappung und Klimawandel: Zwei unterschätzte
Probleme der Gegenwart
Was ist Peak Oil? Warum wir
nicht bis zum letzten Tropfen warten können –
Deutliche Anzeichen: Wir nähern uns dem Umschlagpunkt –
Wann kommt der Wendepunkt? – Klimawandel – Der
Treibhauseffekt – Wo liegt die Grenze des Erträglichen?
– Klimawandel und Ölfördermaximum sind nicht zu
trennen – Klimawandel oder Peak Oil: Was kann die
Öffentlichkeit stärker mobilisieren? – Der
Hirsch-Report und seine Widersprüche
Kapitel
2
Der Blick vom Gipfel
Wie soll es
weitergehen? – Warum wir in Zukunft mit weniger Energie
auskommen müssen – Wozu eine Energiesenkung?
Kapitel
3
Unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken ist so
wichtig wie die Senkung der Emissionen
Was ist
Resilienz? – Drei Bestandteile eines resilienten Systems –
Das gute Leben fing nicht erst mit dem Öl an – Die
Sache mit dem Kuchen – Spuren vergangener Autarkie –
Können wir aus der britischen Mobilmachung im Zweiten
Weltkrieg lernen?
Kapitel 4
Warum
wir viele kleine Lösungen brauchen
Lokalisierungsstrategien
– Biodiesel – Wasserstoff – Lösungen im
großen Stil sind illusorisch und gefährlich –
Kommen die Lösungen von oben oder von unten? – Was
kann die Regierung tun?
Zusammenfassung
|
|
|
|
|
|
|
|
Zweiter
Teil: Das Herz
Warum es entscheidend auf
eine positive Vision ankommt
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitel
5
Wie sich Peak Oil und Klimawandel auf unser Leben
auswirken
»Post-Erdöl-Belastungsstörung«
Kapitel
6
Die Psychologie der Veränderung
Interview
mit Chris Johnstone – Das FRAMES-Modell
Kapitel
7
Die Kraft positiver Visionen
Warum Visionen
funktionieren – Visionen einer reichen Welt
Kapitel
8
Eine Vision für 2030: Rückblick auf die
Energiewende
Ernährung und Landwirtschaft –
Gesundheit und Medizin – Bildung und Erziehung –
Wirtschaft – Verkehr und Energie –
Wohnungsbau
Kapitel 9
Kinsale:
Erster Versuch einer Vision auf kommunaler Ebene
Ein
Energiesparprogramm für Kinsale – Vier Lektionen aus
dem Kinsale-Projekt – Nachbetrachtung – Wie geht es
in Kinsale weiter?
Zusammenfassung
|
|
|
|
|
|
|
|
Dritter
Teil: Die Hände
Von der Idee zur
Umsetzung: Das Energiewendemodell als Motor für die
Entwicklung zukunftsfähiger kommunaler Selbstversorgung
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitel
10
Das Konzept
Die philosophischen Grundlagen
– Sechs Prinzipien als Grundlage des Energiewendemodells –
Das Projekthilfe-Modell – Die Größenordnung –
Die Schnittstelle zwischen Energiewende-Initiativen und
Kommunalverwaltung
Kapitel 11
Wie
gründet man eine Energiewende-Initiative?
Die
sieben Einwände – Die zwölf Schritte auf dem Weg
zur Energiewende
Kapitel 12
Das
erste Jahr der Energiewendestadt Totnes
Hintergrundinformation
und Vorgeschichte – Beispiele für die praktische
Arbeit der Energiewende-Initiative Totnes
Kapitel
13
Die rasante Verbreitung des Energiewendekonzepts
Penwith
– Falmouth – Lewes – Ottery St Mary –
Bristol – Brixton – Forest of Dean
Abschließende
Gedanken
Vielfalt statt
Einfalt. Nachwort von Annette Jensen
Anhänge
– Anmerkungen – Zur Vertiefung – Register
|
|
|
Leseprobe
|
|
Die
Vorreden zu den drei Hauptteilen:
|
|
|
|
|
|
|
|
Erster
Teil: Der Kopf
Ölverknappung
und Klimawandel. Zwei große Probleme, die viele kleine
Lösungen erfordern
|
|
|
|
|
|
|
|
Wir
leben in bewegten Zeiten. Sie ändern sich so rasch, dass uns
schwindlig werden kann, wenn wir bedenken, was uns droht, wenn
wir nichts tun, und welche großartigen Möglichkeiten
sich uns bieten, wenn wir handeln. Meine beiden Grundannahmen
sind ganz einfach. Erstens: Die Periode von 1859 bis heute, die
man, das »Zeitalter des Billigöls« nennen
könnte, geht zu Ende, und das wird für eine so stark
vom Erdöl abhängige Zivilisation wie die unsere
gewaltige Veränderungen bedeuten. Und zweitens: Wenn wir
rechtzeitig und einfallsreich vorausplanen, könnte sich eine
Zukunft mit weniger Öl als weitaus angenehmer als die
Gegenwart erweisen.
Der erste Teil des Buches heißt
»Der Kopf«, weil hier die wichtigsten Fragestellungen
und Theorien verhandelt werden, die der Blick in eine radikal
veränderte Zukunft auf die Tagesordnung setzt. Zunächst
geht es um den »Peak Oil« und den »Klimawandel«:
Beide Begriffe stehen für große Herausforderungen (es
gibt noch viele andere), die sich der Menschheit am Beginn des
21. Jahrhunderts stellen, und sie sind genau deshalb der
wichtigste Antrieb für das Projekt, eine »Energiewende«
herbeizuführen. Beide Probleme sollen hier
allgemeinverständlich dargestellt werden. Ferner wird es
darum gehen, dass wir vieles, was wir als selbstverständlich
annehmen, und auch unsere bisherigen Herangehensweisen radikal in
Frage stellen müssen, wenn wir den Herausforderungen der
Ölverknappung und des Klimawandels gewachsen sein wollen.
Zunächst wird der Peak Oil, das sogenannte Ölfördermaximum,
ausführlich erläutert; denn darüber dürften
viele Leser weniger wissen als über den in den Medien
diskutierten Klimawandel. Der dramatisch steigende Ölpreis
wird aber auch das Peak-Oil-Problem in den gesellschaftlichen
Diskurs rücken, denn in naher Zukunft brauchen wir dafür
dringend Lösungen.
In den folgenden Kapiteln will ich
einerseits beschreiben, was uns in Zukunft erwartet, wenn wir auf
die doppelte Herausforderung nicht mit neuen Ideen reagieren. Zum
anderen soll deutlich werden, welche Vorstellungen bereits
entwickelt wurden. Das Konzept, das die Energiewende-Initiativen
in England vertreten, ist flexibel und gewinnt immer mehr
Anhänger: Es geht hier im Wesentlichen um neue »Techniken«
zur deutlichen Reduzierung der CO2-Emissionen
und um neue Antworten auf Klimawandel und Ölverknappung.
|
|
|
|
|
|
|
|
Zweiter
Teil: Das Herz
Warum es
entscheidend auf eine positive Vision ankommt
|
|
|
|
|
|
|
|
Der
Klimawandel und die drohende Erdölverknappung können
für manche Menschen sehr verstörend wirken. Die meisten
von uns dürften sich daran erinnern, wo sie am 11. September
2001 waren, und die Älteren unter uns werden auch noch
wissen, wo sie sich befanden, als John F. Kennedy ermordet wurde.
In ähnlicher Weise können die meisten Menschen, denen
die Konsequenzen des Klimawandels und das Peak-Oil-Problem zum
ersten Mal richtig bewusst geworden sind, Geschichten von dem
Moment erzählen, als bei ihnen »der Groschen fiel«
und sie, wie ich es manchmal nenne, aus ihrem »Vorstadttraum«
erwachten. Es ist wichtig, sich nicht nur intellektuell mit
diesen Problemen auseinanderzusetzen, sondern sich auch
einzugestehen, dass sie uns emotional aufwühlen und
betroffen machen, denn wie wir mit dieser Betroffenheit umgehen,
entscheidet darüber, wie wir auf die Herausforderungen
reagieren – oder eben nicht reagieren.
Es ist daher
auch wichtig, sich die Kraft positiver Visionen bewusst und
zunutze zu machen. Allzu häufig betreiben Umweltschützer
Angstmache in der irrigen Annahme, mit apokalyptischen
Zukunftsszenarien die Menschen zum Handeln bewegen zu können.
In diesem Teil wenden wir uns deshalb der Frage zu, wie wir
solche Fehler vermeiden und im Gegenteil erstrebenswerte
Zukunftsvisionen entwerfen können, von denen sich die
Menschen unmittelbar angezogen fühlen.
Im Folgenden
will ich dazu einen Beitrag leisten und eine Vision
vorstellen,wie Großbritannien im Jahr 2030 aussehen
könnte,wenn wir den Anpassungsprozess an ein drastisch
vermindertes Energieangebot kreativ in Angriff nehmen und unsere
Zukunft in gesteigerter Widerstandskraft, einer lokalen
Wirtschaft und einem radikal verminderten Energieverbrauch
suchen. Die doppelte Herausforderung von Erdölverknappung
und Klimawandel schafft die einmalige Chance, die Welt um uns
herum neu zu denken, neu zu erfinden und neu zu bauen. Im Kern
dieses Teils des Buches steht die Überzeugung, dass diese
Wende besondere innere Ressourcen erfordert, nicht bloß ein
abstraktes intellektuelles Verständnis. Das ist für die
Umweltbewegung ein relativ neuer Ansatz, doch hängt davon
entscheidend ab, ob wir genügend Unterstützung für
eine grundlegende Energiewende mobilisieren können.
|
|
|
|
|
|
|
|
Dritter
Teil: Die Hände
Von der
Idee zur Umsetzung: Das Energiewendemodell als Motor für die
Entwicklung zukunftsfähiger kommunaler Selbstversorgung
|
|
|
|
|
|
|
|
Es ist
offenkundig, dass es angesichts der oben umrissenen massiven
Veränderungen, die uns bevorstehen, nicht einmal annähernd
ausreicht, die Glühbirnen im Haus auszutauschen und die
Heizung ein paar Grad herunterzudrehen. Im dritten Teil, »Die
Hände«, werden wir uns ansehen, wie wir uns mit
Unterstützung der Gemeinde auf eine Post-Erdöl-Welt
zubewegen können, die tatsächlich erstrebenswerter ist
als die gegenwärtige Welt. Wir stehen an der Schwelle vieler
Entwicklungen und eine davon ist eine beispiellose
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Renaissance. Das Modell,
an dessen Entwurf ich beteiligt war, das Energiewendemodell, ist
eine positive, lösungsorientierte Methode, Menschen einer
Gemeinde zusammenzubringen und auf kommunaler Ebene nach Wegen zu
suchen, um auf Klimawandel und Erdölverknappung angemessen
zu reagieren. Als wir im September 2006 mit Transition Town
Totnes das erste Energiewendeprojekt Großbritanniens auf
den Weg brachten, haben wir im Scherz prognostiziert, dass die
Idee nun um sich greifen werde »wie ein Virus«.
Heute, keine zwei Jahre danach, hat sich der Satz
bewahrheitet.
Die Energiewendebewegung ist innerhalb
kurzer Zeit weltweit zu einer der am schnellsten um sich
greifenden Initiativen auf kommunaler Ebene geworden. In diesem
Teil des Buches werde ich erstens zu definieren versuchen, was
eine Energiewende-Initiative ist, und zweitens die zwölf
Schritte vorstellen, die im Anfangsstadium der Energiewende
notwendig sind, um den Prozess in Gang zu bringen. So sollte der
Leser am Ende der Lektüre gerüstet sein, in seiner
Heimatgemeinde einen solchen Prozess zu initiieren. Die zentrale
Botschaft dieses Abschnitts lautet zum einen, dass wir als
Einzelkämpfer nichts erreichen, und zum anderen, dass
Klimawandel und Peak Oil unser Denken und unsere Entscheidungen
mitbestimmen. Wir müssen größer denken, wir
müssen mit anderen Menschen Hand in Hand arbeiten und wir
müssen unsere Anstrengungen verdoppeln.
|
|
|
Siehe
auch:
|
|
Transition
Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
|
|
|
|
Transition
Towns / Energiewende – Initiativen
|
|
|
|
DeutschlandRadio
Kultur: Ökologie muss Spass machen. Rob Hopkins:
Energiewende
|
|
|
|
Wikipedia:
Permakultur
|