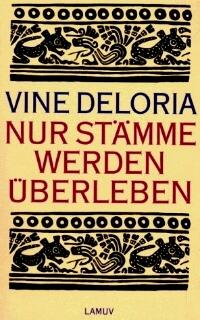|
Leseprobe
|
|
Vorbemerkung
der Herausgeber
Vine Deloria jr. war einer
der ersten nichtangepaßten Indianer mit akademischer
Ausbildung (Jurist), dessen Veröffentlichungen im weißen
wie im roten Amerika gleichermaßen Aufsehen erregten. Sein
Buch Custer Died for Your Sins, das 1969 erschien, wurde
zu einem Bestseller und markierte den Einstieg von Indianern in
die politische Minderheitendiskussion.
Wichtiger
als die breite Anerkennung der liberalen Presse war dabei die
Auslösefunktion für ein neues indianisches Bewußtsein,
wesentlich unterstützt durch die musikalische Umsetzung der
Thesen des Buches in Protestlieder, die der Sioux-Sänger
Floyd Westerman auf einer gleichnamigen Platte
verbreitete.
Selber kein politischer Aktivist, brachte
Deloria aus hinreichender eigener Kenntnis der indianischen
Situation zumindest großes Verständnis für den
Aktivismus auf und billigte ihn in vielen Fällen
ausdrücklich. In der innerindianischen Diskussion nahm er
oft eine bewußt vermittelnde Position ein, um eine breite
Basis des indianischen Widerstands zu schaffen. Vor allem seit
den Ereignissen von Wounded Knee 1973 stand er Methoden und
Zielen des American Indian Movement (AIM) zunehmend
positiv gegenüber. Neben juristischer Hilfestellung bei
zahlreichen Anlässen gilt sein spezielles Interesse den
verfassungsrechtlichen Aspekten und Konsequenzen, die sich für
die indianische Seite aus Vertragsabschlüssen mit der
US-Regierung ergeben, vor allem hinsichtlich einer
völkerrechtlichen Anerkennung existenter und souveräner
indianischer Nationen.
Sein Konzept einer
mehrdimensionalen Strategie, das die Auseinandersetzung mit
Institutionen wie Bureau of Indian Affairs (BIA) und
konventionellen indianischen Organisationen wie National
Congress of American Indians (NCAI) noch nicht für
unentbehrlich hält, hat manchmal Skepsis bei militanten
Indianern hervorgerufen.
Trotzdem ist seine Bedeutung als
Sprecher und Repräsentant eines wesentlichen Teils der
politisch bewußtgewordenen und um Selbstbestimmung und
Souveränität kämpfenden Indianer im Widerstand
unbestritten. Dies zeigt nicht zuletzt die regelmäßige
Veröffentlichung gewichtiger Beiträge und
Stellungnahmen Delorias in der panindianischen Zeitschrift
Akwesasne Notes (AN).
Vine Deloria jr. ist ein
eloquenter und witziger Kritiker des zivilisatorischen Syndroms
der amerikanischen Gesellschaft, der sich rationaler wie
polemischer Mittel zum Zweck der Diagnose bedient. Seine Thesen
und Vorschläge zur Radikalkur westlichen Bewußtseins
sind starke und manchmal bittere Medizin auch für die Linke
im Westen und werden hier in repräsentativer Auswahl zur
Diskussion gestellt.
Es hat fünf Jahre gedauert, bis
dieses Buch (Originaltitel: We Talk, You Listen – New
Turf, New Tribes) hier erstmals veröffentlicht werden
konnte. Das hat unserer Meinung nach Kürzungen nötig
gemacht, vor allem in Passagen, die sich ausführlich mit
Vorgängen der damaligen amerikanischen Innenpolitik
beschäftigten. Einzelne Kapitel sind gestrafft worden. Hinzu
kamen Die Bedeutung von Stämmen, entnommen aus Custer
Died for Your Sins, sowie zwei Interviews und ein Beitrag
Delorias zur aktuellen Situation.
Die Anmerkungen und
Materialien am Schluß eines jeden Kapitels stammen von den
Herausgebern, sind als Anregungen gedacht und sollen das
Verständnis erleichtern.
Claus Biegert
Carl-Ludwig
Reichert
Einleitung
So
manches Mal bin ich von der Denkweise der »Nicht-Indianer«
beeindruckt. 1969 war ich in Cleveland und kam mit einem
»Nicht-Indianer« in ein Gespräch über
amerikanische Geschichte. Er sagte, es täte ihm wirklich
leid, was den Indianern geschehen sei, daß es aber seinen
guten Grund hätte. Der Kontinent müßte entwickelt
werden, die Indianer ständen im Wege und müßten
infolgedessen beseitigt werden. »Was habt ihr überhaupt
mit dem Land getan, nachdem ihr es in Besitz genommen hattet?«
fragte er. Ich verstand ihn erst nicht. Später dann
entdeckte ich, daß der Fluß Cuyahoga, der durch
Cleveland fließt, leicht entzündbar ist. Täglich
werden in den Fluß soviel entzündbare Abfallstoffe
geleitet, daß die Anwohner im Sommer extra
Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen, um einen
plötzlichen Brand zu verhindern. Ich dachte über das
Argument meines »nicht-indianischen« Freundes nach
und fand, daß er wahrscheinlich recht hatte: Die Weißen
hatten das Land besser genutzt. Kein Indianer hätte die Idee
gehabt, einen entzündbaren Fluß zu schaffen!
Vor
125 Jahren brachen die Weißen den mit den Sioux
eingegangenen Vertrag von Fort Laramie, um nach Gold in den Black
Hills graben zu können. Sie brachten das Gold aus den Black
Hills nach Fort Knox, Kentucky, um es dort wieder zu begraben. Im
ganzen Mittelwesten wurden die Indianer von ihrem Land verjagt,
weil die Weißen dachten, sie nützten ihr Land nicht
genug aus. Heute liegt der größte Teil des Landes
brach, und die Besitzer erhalten Geld von der Regierung, damit
nichts angepflanzt wird. Man zerstörte die Wildnis, weil
niemand dort lebte, und baute Städte, in denen niemand leben
konnte.
1969 veröffentlichte eine gelehrte
Anthropologin eine Abhandlung, in der die Trinksucht der Indianer
mit einer Identitätskrise begründet wird. Jeder, der je
einen Indianer traf, würde über diese absurde Idee
lachen. Das Umgekehrte ist nämlich der Fall. Von jedem
Indianer wird man zuerst nach dem Namen, dann nach dem Stamm
gefragt. Manchmal wird man danach zu einem Drink eingeladen. Das
Trinken ist die Bestätigung einer Freundschaft, deren
Bestehen auf der Tatsache beruht, daß man einem bestimmten
Stamm angehört. Um der Beschreibung der Anthropologin
gerecht zu werden, ginge es andersrum: Wir müßten uns
zuerst völlig besaufen, danach den Stamm aussuchen, zu dem
wir gehören wollen, und uns schließlich für einen
Namen entscheiden.
All dies veranlaßt mich, nach
einer klareren Unterscheidung zwischen Temperament, Lebensweise
und Philosophie der Indianer und »Nicht-Indianer« zu
suchen. Das ist schwierig, denn die »Nicht-Indianer«
sind die Nachkommen einer besonderen Gruppe Menschen. Ihre
Vorfahren dachten, sie segelten bis zum Ende der Welt, und hätten
das auch getan, wenn wir sie nicht an Land gezogen hätten.
Ihre Nachfolger verschwendeten mit jahrelangen Reisen auf der
Suche nach dem Brunnen der Jugend und den Sieben Städten aus
Gold viel Zeit. Bei ihrer Ankunft wußten sie nicht einmal,
wie man eine einzige Stange Mais pflanzt. Der »Nicht-Indianer«
glaubt beharrlich an seine Ideen und ändert sich selten.
Es
geschieht heute viel, das mit den Ideen, Bewegungen und Vorfällen
im Lande der Indianer in Verbindung gebracht werden kann –
so viel, daß man bei näherer Betrachtung stutzt. Ohne
es zu merken, wird die amerikanische Gesellschaft indianisch.
Stimmungen, Ansichten und Wertmaßstäbe ändern
sich. Trotz der Vergötterung des rauhen Individuums, das
niemanden braucht, werden sich die Menschen ihrer Isolation immer
häufiger bewußt. Der selbstgenügsame Mensch sucht
nach einer Gemeinschaft, die er als die seine bezeichnen kann.
Die schillernden Verallgemeinerungen und Mythologien der
amerikanischen Gesellschaft sättigen nicht mehr den Drang
und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit.
Kommunikation
erweist sich als eine fast unüberwindliche Aufgabe. Man kann
nicht so einfach von der Stammeslebensweise in die Ideenwelt der
»Nicht-Stammesmenschen« überwechseln. Der
»Nicht-Stammesmensch« denkt mit einer linearen Logik,
in der B und C auf A folgen. Wert und Bedeutung des ganzen
Geschehens werden vom »Nicht-Stammesmenschen« selten
verstanden, obwohl er durch seine Logik vielleicht genauere
Informationen über die Sachlage erhält. Er kann den
Abstand zum Mond mit unbeirrbarer Genauigkeit messen, der Mond
bleibt jedoch ein neutrales Objekt ohne persönliche
Beziehung, die die innersten Gefühle unterstützen und
hervorheben würde.
Die Stammesgesellschaft ist von
solcher Natur, daß man sie von innen heraus erfahren muß.
Sie ist ganzheitlich-logische Analyse, führt ohne
dazugewonnene Erfahrung zum Ausgangspunkt zurück. Das Leben
in einer Stammesgemeinschaft ist so wohldurchdacht und behaglich,
daß es fast wie eine Droge wirkt. Der Mensch, der mit
Gewalt aus diesem System herausgenommen wird, wird reizbar und
einsam. Er sehnt sich verzweifelt nach einer Rückkehr zum
Stamm, manchmal nur, um seinen gesunden Verstand zu bewahren.
Zwar lebt die Mehrheit der Indianer heute in den Städten,
doch sind ziemlich viele von ihnen lange Wochenenden auf dem
Reservat, um kostbare Stunden auf ihrem eigenen Land mit ihren
Leuten zu verbringen.
Die beste Methode, indianische Werte
verständlich zu machen, ist die, Punkte zu finden, in denen
Streitfragen sich überschneiden. Da das Gefüge der
Stammesgemeinschaft auf ein Zentrum hin ausgerichtet ist und die
»nicht-indianische« Gesellschaft sich an linearer
Entwicklung orientiert, könnte man diesen Prozeß mit
einem Kreis mit Tangenten vergleichen. Die Punkte, wo die Linien
den Umfang des Kreises berühren, sind die Streitfragen und
Ideen, die Indianer mit anderen Gruppen teilen. Es gibt viele
solcher Punkte. Sie können als Fenster betrachtet werden,
durch die Indianer und »Nicht-Indianer« sich sehen
können. Ist dieses Muster angewandt und verstanden, kann der
»Nicht-Indianer«, indem er sich stammesgemäßer
Betrachtungsweise bedient, sich selbst und seine Beziehung zu den
Indianern besser verstehen.
Das Problem wird durch die
Geschwindigkeit moderner Kommunikationsmittel komplizierter. Sie
überschwemmen uns mit Nachrichten, die Nachrichten sind,
weil sie als Nachrichten berichtet werden. Bei einer linearen
Weltanschauung erweckt die Folge spektakulärer Ereignisse
den Eindruck, mit der Welt gehe es entweder bergauf oder bergab.
Ereignisse werden wegen ihrer bekräftigenden oder drohenden
Aspekte, nicht aber wegen ihrer wirklichen Bedeutung beachtet, da
sie selbst keine Interpretationsmöglichkeiten enthalten.
Wenn wir unfähig sind, die Ereignisse, die durch die Medien
berichtet werden, in uns aufzunehmen, stützen wir unsere
Interpretation über den Sinn der Welt eher auf das, was uns
gelehrt wurde, als auf das, was wir selbst erfahren haben.
Die
Indianer unterliegen der Informationsflut genau wie andere Leute.
In den sechziger Jahren sind die meisten Reservate in die
Reichweite von Fernsehen und Computer gekommen.
In vieler
Hinsicht werden Indianer, wie jede andere Gruppe auch, von der
elektrischen Natur unseres Universums beeinflußt. Aber die
Anschauungen des Stammes nehmen sofort auf, was berichtet wurde,
und integrieren es in die Erfahrung der Gruppe. Vielerorts werden
die Weißen nur als eine vorübergehende Erscheinung
betrachtet, und es besteht der unerschütterliche Glaube, daß
der Stamm die Herrschaft des weißen Mannes überleben
und den Kontinent wieder beherrschen wird. Indianer saugen die
Welt auf wie ein Fließblatt und führen ein von äußeren
Ereignissen unberührtes Leben. Je gründlicher das
geschieht, desto besser scheint der Stamm zu funktionieren und
stärker zu werden. Von allen Gruppen in der modernen Welt
sind die Indianer am besten gerüstet, mit neuartigen
Situationen fertig zu werden.
Die »nicht-indianische«
Welt jedoch ist der Ansicht, daß Indianer zu nichts fähig
sind. Es ist die Flexibilität der stammesmäßigen
Weltanschauung, die Indianern ermöglicht, verheerenden
Situationen gelassen gegenüberzutreten und sie zu überleben.
Aber gerade diese Flexibilität wird von »Nicht-Indianern«
als Unfähigkeit gewertet; das hat zur Folge, daß der
»Nicht-Indianer« in Einsamkeit und Verzweiflung
draufloskämpft und den Indianer wegen seiner
Nichtanteilnahme verwünscht.
1969 begannen
»Nicht-Indianer« die Indianer wieder zu entdecken.
Wir wurden von allen als natürliche Verbündete im
uralten Kampf gegen die »bösen Mächte«
gepriesen. Konservative umarmten uns, weil wir uns weder
hochmütig benahmen noch in ihre Nachbarschaft zogen und auch
nicht durch ihre Straßen marschierten. Die Liberalen
liebten uns, weil wir das unterdrückteste aller
unterdrückten Völker waren und außerdem zumeist
demokratisch wählten. Die Schwarzen mochten uns, weil wir
gegen die Politik des Innenministeriums waren. (wir wären
sogar dagegen, wenn wir das verdammte Ding selber erfunden
hätten), was darauf hinzuweisen schien, daß wir eine
weitere Gruppe wären, mit der man bei der kommenden
Revolution rechnen konnte.
Im Herbst 1969 war ich auf
einer Konferenz, wo eine Anzahl wütender Militanter ihre
Meinung über die kommende Revolte vortrugen. Mit fieberndem
Eifer beschrieben sie die »Schlacht von Armaggeddon«,
in der die »Schweine« besiegt und die Schwachen die
Welt (oder ein ansehnliches Faksimile davon) erben würden.
Als man einen alten Sioux fragte, ob er denn den Sturz der
Regierung unterstütze, antwortete er: »Nicht eher, als
bis wir für die Black Hills bezahlt worden sind.« Ich
muß kaum noch betonen, daß jene Revolutionäre
von der indianischen Begeisterung für radikale Änderungen
nicht besonders beeindruckt waren.
Hippies zeigten uns
stolz ihre Perlen und grüßten mit wissendem Lächeln
und ein paar Brocken Navaho, das sie auf ihrer Reise durch
Arizona gelernt hatten. Wir sahen verwundert zu, als sie befedert
und in Wildleder gekleidet Revue passierten, sorgsam darauf
bedacht, eine Rolle zu spielen, die sie selbst nicht ganz
verstehen konnten. Als die Indianer Alcatraz besetzten, kamen die
Hippies in Schwärmen zur Insel und suchten den Horizont Zoll
für Zoll nach einer Vision des Menschen im vormaligen
Naturzustand ab. Als sie herausfanden, daß die
Stammesmenschen die gleichen Organisationsprobleme hatten wie
andere Gruppen auch, zogen sie ab, enttäuscht und ernüchtert
von einem Indianertum, das nur in ihrer Vorstellung existiert
hatte.
Fast ein Jahr lang versuchten die unterschiedlichen
Minoritäten und Machtgruppen, Indianer für die sozialen
Krisen, die das Land heimsuchen, zu interessieren. Die Kirchen
gaben Riesensummen für die Bildung von »Sonderkommissionen«
aus. Bestehend aus »unabhängigen« Indianern,
sollten sie über indianische Probleme im gesamten Bereich
der Nation informieren. Man war enttäuscht, als die Indianer
nicht sofort Gewaltmaßnahmen als Mittel zur Besserung
vorschlugen.
Regierungsangestellte versuchten, Indianer
innerhalb des städtischen Zusammenhangs zu verstehen, ein
Zusammenhang, der sogar dem unentwegtesten Städter nichts
mehr bringt.
Konservative suchten uns des öfteren
auf, um uns unser mystisches Wissen über die Bebauung des
Landes zu entreißen.
Zweifellos gibt es eine große
Krise. Ich glaube jedoch, daß die Ursachen tiefer liegen
als Worte wie Rassismus, Gewalttätigkeit oder
wirtschaftliche Verelendung andeuten.
Die philosophischen
Konzepte der amerikanischen Gesellschaft ändern sich von
Grund auf. Worte werden ihrer alten Bedeutung beraubt, und neue
Worte füllen das Vakuum. Rassenkämpfe, Inflation,
Umweltverschmutzung und die Bildung von Machtgruppen sind Symbole
einer neuen Anschauung vom Menschen und seiner Gesellschaft. Das
heutige Denken löst sich vom Konzept der Autonomie des
Individuums und sucht nach einer neuen, vorerst noch nicht genau
bestimmten Definition des Menschen als Mitglied einer
spezifischen Gruppe.
Das ist ein extrem schwieriges
Übergangsstadium für jede Gesellschaft. Anstatt die
Situation klar zu erkennen, hat man es aber vorgezogen, soziale
Probleme als Ausdruck einer Kluft zwischen bestimmten Elementen
der nationalen Gemeinschaft zu sehen. Offensichtlichstes Beispiel
für diese Haltung ist das Gerede über den sogenannten
Generationskonflikt. Zu anderen Zeiten wird dieselbe Sache als
Rassenproblem dargestellt – die weiße, rassistische
Machtstruktur gegen die unschuldigen, friedliebenden
Minderheiten. Wir wissen, daß das falsch ist.
Die
Schwarzen waren in den von ihnen verantworteten Programmen nicht
weniger rassistisch gegen die Indianer als die Weißen gegen
sie selbst. Hinter jeder Bewegung taucht die Gruppe als
bestimmende Struktur auf. Solange nicht die Kenntnisse von der
Natur der Massengesellschaft erweitert und von der Mehrheit der
Menschen akzeptiert sind, wird es kaum Frieden in dieser
Gesellschaft geben.
Man kann aber nicht ständig von
einer Gruppe zur anderen laufen und Bewegungen und Ideen
untersuchen um herauszubekommen, ob sich alles richtig
entwickelt. Ein besserer Weg, Ereignisse zu verstehen, ist,
vorhandene Ähnlichkeiten in der Struktur zu finden. Bei
Beachtung der philosophischen Unterschiede können
Verallgemeinerungen dieser Art sehr nützlich sein. Es
scheint mir, daß die moderne Gesellschaft vor einer
Alternative steht. Die Amerikaner werden aufgrund der
Kompliziertheit moderner Kommunikations- und Verkehrsmittel in
neue soziale Formen gezwungen. Das neue Stammestum konkurriert
dabei mit dem Neo-Feudalismus. Der Kampf der Zukunft geht um die
Rückkehr – zum Schloß oder ins Tipi.
Der
Unterschied zwischen Schloß und Tipi ist sehr groß
und doch bestehen Ähnlichkeiten, die es erschweren, sie zu
unterscheiden. Beide bieten gesellschaftliche Identität und
wirtschaftliche Sicherheit innerhalb eines bestimmten
gemeinschaftlichen Systems. Wobei der ausgleichende Prozeß
innerhalb der Stammesform die erbliche Kontrolle über eine
soziale Pyramide verhindert, die feudalistische Form aber die
Effizienz besitzt, Technologien zu schaffen und zu kontrollieren.
Beides brauchen wir, wenn wir Herren der Maschine bleiben wollen,
anstatt uns zu unterwerfen.
Viele Menschen können und
wollen die Rückkehr zum Schloß unterstützen. Wir
haben Camelot überlebt und die universale Sehnsucht nach
seiner Wiederkehr. Die Masse der korporativen
Unternehmerorganisationen hat uns weit in Richtung
Neo-Feudalismus getrieben. Andererseits weist das beständige
Scheitern des totalen Wirtschaftssystems beim Versuch, der
Bevölkerung wie den Korporationen zu helfen, auf die
Notwendigkeit, soziale Ziele mehr in Einklang mit einer
stammesmäßigen oder gemeindebildenden Lebensweise
anzusteuern.
Stammestum kann nur als Mosaik dargestellt
werden.
Eine solche Darstellungsweise ist neuartig. Keine
einzelne Idee führt notwendig zur nächsten. Die
Gesamtheit des Stammestums hängt solchermaßen auch
nicht von der Annahme einer einzelnen These ab. Auch wenn
Ereignisse und Ideen einem nicht unmittelbar einsichtig sind,
löscht die Zeit sie deswegen nicht völlig aus, sondern
bewahrt sie für spätere Problemlösungen.
Nachdem
ich die sozialen Probleme von verschiedenen Seiten betrachtet
habe, kann ich daraus nur eine Schlußfolgerung ziehen:
Amerika braucht eine neue Religion.
Fast jedes Ereignis,
fast jede Bewegung heutzutage erfüllt ansatzweise diese
Rolle, nichts aber hat den zentralen Zugriff, der es ermöglichen
würde, Wurzeln zu schlagen und zu überleben. Ich
schlage keineswegs eine Rückkehr zum Christentum vor. Diese
»Religion« hat 2000 Jahre Heuchelei und Blutvergießen
hinter sich und kaum etwas anderes bewirkt, als Menschen in
Maschinen zu verwandeln.
Wir stehen wahrscheinlich an der
Schwelle eines Zeitalters, wo religiöses Fühlen durch
festen Zusammenhang mit den Werten rassischer und ethnischer
Gruppen ausgedrückt wird. – Verweltlichung religiöser
Gefühle, ausgedrückt in politischer Aktion.
Sollte
meine Schlußfolgerung stimmen, ist es notwendig, den
indianischen Standpunkt klarzumachen; Verallgemeinerungen unter
dem Gesichtspunkt, wie gleich wir alle sind – alle Menschen
–, sind heutzutage unnütz. Gültige Ansichten,
eine neue Logik, und verschiedene Ziele definieren uns. Was wir
tun können, ist, versuchen zu vermitteln, was für unser
Gefühl das Selbstverständnis unserer Gruppe darstellt
und welche Beziehungen wir zu anderen Gruppen haben. Einander als
verschiedene Menschen zu verstehen, ist die wichtigste Sache
überhaupt.
Was
den Standpunkt betrifft, gibt es wirklich einen Unterschied.
Eines Tages erzählte ein Mann seinem Sohn von seinen
Kriegserlebnissen: »Wir waren umzingelt von Tausenden von
Feinden. Kugeln pfiffen um unsere Köpfe. Wir hatten kein
Wasser mehr. Es gab nichts zu essen, und die Munition wurde
knapp. Plötzlich hörten wir in der Ferne eine sehnlich
erwartetes Geräusch – indianisches
Kriegsgeschrei.«
Vine Deloria jr. (1970)
|