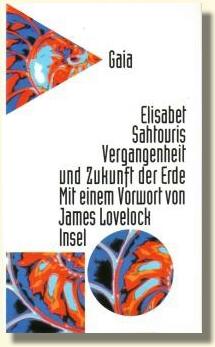|
langelieder > Bücherliste > Sahtouris, Gaia |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
Elisabet
Sahtouris |
||
|
|
Originaltitel: The Human Journey from Chaos to Cosmos |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Die
sogenannte Gaia-Theorie ist längst nicht mehr als kauzig in
Verruf, sondern hat, nicht zuletzt auch durch die Globalkonferenz
in Rio, wissenschaftliches Ansehen erhalten. Bei dieser Theorie
geht es um das Verständnis der Erde als eines lebendigen
Systems, eines lebendigen Organisnius: sich selbst – nach
kritischen, meteoriten-bombardierten Anfängen –
stabillsierend und sich selbst entwickelnd. |
|||
|
|
||||
|
Elisabeth Sahtouris |
|
ist Biologin und lebt in den USA und in Griechenland; sie ist Mitglied zahlreicher Gremien zum globalen Umweltschutz. |
||
|
|
||||
|
Inhaltsverzeichnis |
|
Vorbemerkung |
||
|
|
|
Vorwort von James E. Lovelock |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
1. |
|
Eine zweimal erzählte Geschichte |
|
|
|
2. |
|
Die Anfänge des Kosmos |
|
|
|
3. |
|
Die junge Erde |
|
|
|
4. |
|
Die problematische Kindheit der Erde |
|
|
|
5. |
|
Der Tanz des Lebens |
|
|
|
6. |
|
Ein großer Sprung |
|
|
|
7. |
|
Die bewiesene Evolution |
|
|
|
8. |
|
Von den Protozoen zu den Polypen |
|
|
|
9. |
|
Von den Polypen zu den Opossums |
|
|
|
10. |
|
Von den Opossums zu den Menschen |
|
|
|
11. |
|
Der Versuch mit dem großen Gehirn |
|
|
|
12. |
|
Um was es im Spiel des Lebens geht |
|
|
|
13. |
|
Weltanschauungen, Teil 1 – vom Pleistozän zu Plato |
|
|
|
14. |
|
Weltanschauungen, Teil 2 – von Plato bis in die Gegenwart |
|
|
|
15. |
|
Weniger als perfekt, aber mehr als eine Maschine |
|
|
|
16. |
|
Der Körper der Menschheit |
|
|
|
17. |
|
An der Schwelle zum Erwachsenwerden? |
|
|
|
18. |
|
Ökologische Ethik |
|
|
|
19. |
|
Leben – ein kosmisches Phänomen |
|
|
|
|
||
|
|
|
Literaturverzeichnis |
||
|
|
||||
|
Leseprobe |
|
Vorbemerkung |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Dieses Buch versucht, der Philosophie in ihrem ursprünglichen Sinn gerecht zu werden – das heißt: es beschäftigt sich mit der Suche des Menschen nach Wissen und seinem Bemühen, sich in der natürlichen kosmischen Ordnung zurechtzufinden. Infolgedessen hat es wenig mit der heutigen Philosophie zu tun, die wir nach ihrer Trennung von den Naturwissenschaften eher als eine intellektuelle Übung als eine praktische Lebenshilfe verstehen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Um Natur zu verstehen und ihrem Sinn folgen zu können, verband ich meine persönlichen Naturerfahrungen mit dem wissenschaftlichen Material, das ihnen am besten zu entsprechen schien. Aus dieser Synthese ergaben sich der Sinn und die Lektionen, die wir Menschen daraus ziehen sollten, ganz von selbst. Das Buch entstand in der friedlichen Abgeschiedenheit eines kleinen Dorfes auf einer pinienbedeckten griechischen Insel. Diese Umgebung erwies sich für die Erkenntnisse, die ich aus den diversen wissenschaftlichen, historischen und philosophischen Arbeiten über die Natur gewonnen hatte, als eine ideale »Teststrecke«. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Der Versuch, die spezialisierte, technische Sprache der Wissenschaft einfacher auszudrücken, und mein beschwerlicher Weg durch die Labyrinthe der philosophischen Prosa ließen mich allmählich die Ursprungsgeschichte und Entwicklung unseres Planeten in ein Bild der größeren kosmischen Ordnung einfügen und die Entwicklungsgeschichte des Menschen in die umfassendere des Planeten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Die zentralen Begriffe meiner philosophischen Anschauung basieren auf der von James Lovelock und Lynn Margulis formulierten Gaia-Theorie, derzufolge unser Planet und seine Lebewesen ein sich selbst regelndes System bilden, das tatsächlich nichts anderes ist als ein großes lebendiges Wesen, ein riesiger Organismus. Diese Theorie ist in allen in Frage kommenden Ebenen – seien sie intuitiver, wissenschaftlicher, philosophischer und selbst ästhetischer Natur – einfach plausibler als jedes andere Konzept, das ich kenne. Während der Arbeit an diesem Manuskript bin ich zudem zu der Überzeugung gekommen, daß die Tragweite dieser Theorie für die gesamte Menschheit von tiefer und zwingender Bedeutung ist. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Um sicherzugehen, daß meine Vorstellung über die Evolution und Geschichte einfach und klar blieb, erzählte ich in der Art eines Geschichtenerzählers der Antike (wenngleich auch weniger poetisch) den griechischen Freunden aus meinem Dorf im Verlauf vieler Abende immer wieder ihre Grundzüge und einige ihrer besonderen Details. In Englisch schrieb ich meine Überlegungen zuerst in einer für Kinder gedachten Version nieder, bevor ich mich an die Fassung für die Erwachsenen machte. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Zu meiner Überraschung erwies sich das Schreiben dieses absichtlich einfach gehaltenen Textes als weitaus schwieriger als das Verfassen einer für Fachkreise bestimmten Version. Der Grund liegt darin, daß wir nur dann unsere intellektuelle Sprache aufzugeben bereit sind, wenn wir uns sicher sind, daß unsere Aussagen auch einen wirklich schlüssigen Kern haben. Die Wissenschaften sind gekennzeichnet von einem Prozeß der Ausdifferenzierung unseres Wissens in immer mehr präzise Einzelheiten. Da diese Einzelheiten sich aber immer stärker voneinander abtrennen und förmlich nach Integration schreien, habe ich versucht, sie als in einem Zusammenhang stehende Ganzheiten darzustellen. Zweifelsohne kann man darin eine Übervereinfachung sehen, vielleicht sogar zu Recht, da man den Überblick mit einem Verlust an Details und Präzision bezahlt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Von Freunden und Kollegen bekam ich immer wieder zu hören, warum ich bei meiner Auseinandersetzung mit den spezifisch die Menschen tangierenden Fragen darauf bestünde, mich gleich mit der ganzen Evolution und sogar dem Kosmos zu beschäftigen, statt mich auf überschaubare Verhältnisse zu beschränken. Meine Antwort ist, daß sich die Bedeutung der Dinge nur über den Kontext erschließt und eine ernsthafte Suche nach solch einem Zusammenhang unvermeidlich in die größten Zusammenhänge überhaupt führt: die des gesamten Kosmos. Als ich immer größere Klarheit über die Zusammenhänge der menschlichen Entwicklung – besonders den der Evolution gewann, wurde mir in einem einfachen, aber schlüssigen biologischen Gedankengang bewußt, warum gerade die Verfassung des Menschen so kritisch geworden ist und was wir tun könnten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Andere fragen, warum ich so erpicht darauf sei, die Menschheit zu retten, wo sie doch ein solch soziales und ökologisches Desaster hervorbringt. Darauf kann ich nur antworten, daß, so weit ich es beurteilen kann, in der Natur jedes Lebewesen oder lebende System ein mit seinem Überleben vereinbares Verhalten entwickelt hat und ich mich auch als Teil dieses natürlichen Prinzips betrachte. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Spricht man mich auf die »Realität« der aus meiner Arbeit resultierenden Sichtweise an, so geht es mir nicht anders als jedem anderen Philosophen, der zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort eine Weltanschauung formuliert, indem er sich auf die zu dieser Zeit und diesem Ort verfügbaren wissenschaftlichen und historischen Daten stützt. Philosophie ist eine intensive persönliche Suche, von der man hofft, daß sie für andere Menschen eine Bedeutung gewinnt, daß sie sich in der Erfahrung dieser anderen Menschen bestätigt, daß sie diesen anderen einen gewissen Einblick und eine bestimmte Einstellung vermitteln kann oder daß sie wenigstens andere Menschen dazu stimuliert, für sich selbst weiterzusuchen, falls sie mit dieser Philosophie nicht einverstanden sein sollten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Dennoch reflektiert ein philosophisches Werk aber auch das zum Zeitpunkt seiner Entstehung herrschende Umfeld samt seiner kulturellen Orientierung. So spiegelt der biologische und evolutionäre Standpunkt dieses Buches die gegenwärtige, verbreitete und vielfältige Suche nach unseren Ursprüngen und unserem zukünftigen Verhältnis zur Natur. Dies kann man als eine Renaissance der in der Philosophie schon bei den Vorsokratikern einsetzenden Suche nach re-ligio begreifen (oder noch weiter zurückreichend nach den Wurzeln der Religion überhaupt), nach der »Wiederverbindung« mit unseren Ursprüngen in der Natur oder dem Kosmos, aus dem heraus wir entstanden sind und in dem wir unsere Zukunft gestalten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Paradoxerweise hat unsere während der letzten Jahrtausende selbstauferlegte Trennung von der Natur – in Gestalt einer »objektiven« mechanistischen Weltanschauung – zu einem Wissenschaftsverständnis geführt, durch das wir in der Lage sind, uns als reintegrationsfähigen Teil der Selbstorganisation der Natur zu begreifen. Dieser Trennungsprozeß hat uns auch einen Grad an Technologie »beschert«, der uns erlaubt, unsere Entdeckungen und unsere Erkenntnisse weltweit ohne Zeitverlust allen zugänglich zu machen und gleichsam als ein aus allen Menschen bestehender Organismus zusammenzuarbeiten, um auf diese Weise unsere gegenwärtige Krise in eine gesündere und glücklichere Zukunft für uns selbst und alles übrige Erdenleben zu verwandeln. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Obwohl dieses Buch in relativer Isolation geschrieben wurde, bin ich vielen meiner Lehrer und Freunde zu großem Dank verpflichtet – angefangen von den Weggefährten meiner frühen Kinderjahre bis zu Jim Lovelock und Lynn Margulis, die mich in den letzten Jahren nicht nur informiert und inspiriert haben, sondern mich durch ihre Ermutigung und ihren Zuspruch darüber hinaus in den Stand versetzten, das Buch zu Ende zu bringen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Elisabet Sahtouris |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Vorwort |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Wie wir alle, reift auch die jetzt in den Rang einer Theorie aufgerückte Gaia-Hypothese durch die mit der Zeit zunehmende Erfahrung. Von dieser Theorie geht ein großer Impuls zur geophysiologischen Erforschung unseres Planeten aus, und sie befruchtet auch das philosophische Nachdenken darüber, was es für den Menschen heißt, Teil eines lebenden Planeten zu sein. Einige aus dieser Reflexion hervorgegangene Vorstellungen bewegen sich innerhalb des allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Terrains, andere haben hingegen einen religiösen Einschlag. Die meisten dieser Ideen, vor allem die ökologischen Konzepte, befassen sich in erster Linie mit den Überlebensmöglichkeiten des Menschen. Ein paar andere – die auf den Vorstellungen von meiner Partnerin Lynn Margulis und mir basieren – treten jedoch für den Planeten als Ganzes und damit auch für die übel beleumundeten Mikroben ein, mit denen das Gaia-Systern überhaupt entstand und die nach wie vor die grundlegende Arbeit in diesem System verrichten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
In der Konzeption von Elisabet Sahtouris verbindet sich der wissenschaftlichen Kriterien genügende evolutionstheoretische Aspekt des Gaia-Modells mit der dem Menschen eigentümlichen Suche nach seinen Wurzeln zu einer Synthese, die es uns ermöglicht, aus der bereits einige Milliarden Jahre bestehenden »gaianischen« Erfahrung in der Selbstorganisation funktionstüchtiger lebender Systeme zu lernen. Diese Synthese trägt sowohl den Bedürfnissen unseres Planeten als auch unseren eigenen, spezifisch menschlichen Interessen Rechnung, ohne uns allerdings in unserem unreifen Glauben zu belassen, diesen Planeten nach unserem Gutdünken benutzen zu können. Statt dessen täten wir besser daran, uns bei der Organisation unseres Überlebens nach diesem gaianischen System zu richten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Elisabet Sahtouris zieht eine Parallele zwischen der Evolution der Zellen und der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft, weiterhin macht sie den Gegensatz zwischen der gesunden Organisation der Zellen, Körper und Biosysteme einerseits und der andererseits kaum mit dem Gesundheitsbegriff zu vereinbarenden Organisation der Ökonomie und Politik der menschlichen Gesellschaft deutlich. Mit ihrem Hinweis, daß wir unsere gesellschaftliche Entwicklung nicht in dem Grad unter Kontrolle haben, wie wir dies glauben, macht sie uns darauf aufmerksam, daß unser Überleben in großem Maße davon abhängt, wie wir der – vom Standpunkt der Evolution aus – notwendigen Forderung zur Umwandlung der vom Konkurrenzdenken geprägten Strategie der Ausbeutung zu einer kooperativen Synergie gerecht werden. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Da Elisabet Sahtouris die Mühe auf sich genommen hat, direkt von der Natur als auch von dem sich stetig vergrößernden Bestand wissenschaftlicher Informationen über die Natur zu lernen, machen ihre Ratschläge insgesamt Sinn. Das Vorwort für mein eigenes Buch The Ages of Gaia (dt. Das Gaia-Prinzip. Die Biographie unseres Planeten) begann ich mit der Bemerkung, daß zum Verständnis eines Buches auch der Ort, an dem es geschrieben wurde, beitrüge. Wenn man, wie ich in Devonshire, weitab von den Universitäten und den großen Forschungsinstitutionen auf dem Land lebt und arbeitet, wird man als Wissenschaftler leicht zum Exzentriker, was aber, nach meiner Meinung, der einzige Weg ist, über ein solch unkonventionelles Thema wie die Gaia-Theorie nachzudenken. Nachdem ich Elisabets Einladung, Gaias Spuren in Griechenland nachzugehen, angenommen hatte und sie dort traf, erkannte ich in ihr die gleichgesinnte Persönlichkeit. Sie hatte ihre akademische Laufbahn für ein einfaches Leben in einer natürlichen Umgebung aufgegeben, in der sich die Bedeutung unseres Planeten und unserer eigenen Spezies unmittelbar erfahren läßt. Dadurch besaß sie die Freiheit, in einer Synthese aus wissenschaftlicher Kenntnis und persönlicher Naturerfahrung ihre eigenen Vorstellungen zur Gaia-Hypothese zu entwickeln. Zu meiner Überraschung äußerte sie einige Bedenken und Schuldgefühle, ihren wissenschaftlichen Beruf zugunsten einer angenehmeren Lebensweise in frischer Waldluft mit Blick aufs Meer aufgegeben zu haben. Sie lebte jetzt in einer ähnlichen Umgebung wie in ihrer Kindheit und war so in der Lage, sich Klarheit über die für sie wichtigen Dinge zu verschaffen. Nachdem ich mit der Lektüre des gesamten Manuskripts begonnen hatte, konnte ich ihr nach wenigen Seiten versichern, daß sie etwas Vergleichbares in einer von Zwängen gekennzeichneten akademischen Umgebung niemals zu schreiben imstande gewesen wäre. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
In den letzten Jahren, selbst in der kurzen Zeit, die vergangen war, seitdem ich in meinen eigenen Texten den unkonventionellen Charakter der Gaia-Hypothese betont hatte, haben weniger exzentrische Wissenschaftler als ich die Gaia-Theorie in einer konventionelleren Weise ausgelegt, was bedeutet, daß dieses Konzept mittlerweile als eine durchaus legitime und fruchtbare Grundlage wissenschaftlicher Forschung behandelt wird und deshalb Eingang in die wissenschaftliche Gemeinde gefunden hat. In unserer ersten Darstellung, die Gaia als System konzipierte, verstanden weder Lynn Margulis noch ich genau, was wir damit eigentlich beschrieben haben. Unsere Sprache hatte einen anthropomorphischen Charakter und speziell mein erstes Buch Gaia (dt. Unsere Erde wird überleben. Gaia – Eine optimistische Ökologie) eine eher poetische Diktion. Insofern war es keine Überraschung, daß einige Wissenschaftler unsere Absichten mißverstanden und uns bezichtigten, wir behaupteten, daß die Organismen nach einem ihnen eigenen Zweck handelten, um so die chemische Zusammensetzung und das Klima der Erde zu regulieren. Die Vorstellung, daß natürliche Systeme einem Zweck unterliegen, verletzt ein wissenschaftliches Tabu, ist sogar reine Ketzerei. In der klarer strukturierten, modernen Gaia-Theorie wird diese Häresie vermieden. In dieser Theorie ist die Evolution der materiellen Umgebung und die Evolution der Lebewesen zu einem einzigen untrennbaren Vorgang oder Bereich verkoppelt. Gaia ist mit ihrer Fähigkeit zur Homöostase dann nichts anderes als eine aus diesem Prozeß hervorgehende Eigenschaft. Infolgedessen wird es überflüssig, bei der Beschreibung der Evolution dieses Bereiches mit Vorstellungen von einem Zweck oder einer Vorausbestimmung zu operieren. Gleiches trifft dann auch für die in diesem Gaia-Prozeß stattfindende Evolution des menschlichen Körpers zu. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Wie die Überschrift eines in Science erschienenen Artikels: »Nicht mehr länger eine kauzige Theorie – Gaia bekommt wissenschaftliches Ansehen« schließen läßt, werden diejenigen Wissenschaftler, die sich mit Gaia befassen, die Fesseln der Bürokratie, die mit einer festen Anstellung verbundenen Zwänge und die »stammesüblichen« Aufteilungen und Gesetze der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen zu spüren bekommen. Daraus folgt, daß wir gegen die absehbaren Aufspaltungen und Zwänge ein Gegengift brauchen. Wir werden vom Wissenschaftsbetrieb unabhängige Vermittler mit visionären Fähigkeiten benötigen, denen es gelingt, die von den Wissenschaftlern gefundenen Daten so zu übersetzen und zu vermitteln, daß wir unsere Erde als einen – in der gaianischen Bedeutung – lebendigen Planeten begreifen, woraus sich letztendlich auch der Sinn unseres eigenen Lebens und das unserer Kinder und Kindeskinder erschließt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Hier sehe ich die Leistung von Elisabet Sahtouris. Dadurch, daß sie die traditionell voneinander getrennten Fächer der Biologie, Geologie und Atmosphärenphysik zu einem neuen wissenschaftlichen Verständnis integriert, macht sie uns die Evolution unseres lebendigen Planeten und unserer eigenen Wurzeln innerhalb dieses Systems deutlich. Außerdem regt sie uns an, über dieses planetare Lebewesen, dessen Teil wir sind, nachzudenken und von ihm zu lernen, wie wir die zukünftige Beteiligung unserer Spezies am »Tanz des Lebens« gewährleisten können. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Elisabet Sahtouris verwendet die Metapher des Tanzes dann, wenn sie uns ihre Vorstellungen über Improvisation und Evolution, über die Entstehung der Ordnung aus dem Chaos und über die unendliche, aus einigen wenigen Grundmustern hervorgehende Strukturvielfalt näherbringen will. Für mich als Erfinder wissenschaftlicher Instrumente hingegen ist es zu einer zweiten Natur geworden, in mechanischen und mathematischen Kategorien zu denken. Besonders in meinem Arbeitsfeld, bei dem es sich hauptsächlich um die Funktionsweise der gaianischen Homöostase handelt – zum Beispiel bei der Aufrechterhaltung der Erdtemperatur –, hat sich die Verwendung kybernetischer Modelle als sehr nützlich erwiesen. Dennoch stimme ich Elisabet Sahtouris zu, daß jedes Modell, das wir uns von der Natur machen, im Grunde eine Metapher ist, da es meist mit einer uns Menschen vertrauten Vorstellung oder Formel beginnt und dazu dient, uns die Komplexitäten der Natur in einfacher, verständlicher und sinnvoller Weise darzustellen. Eine Metapher sollte allerdings nicht als Realität verkannt werden, und vielleicht schützt uns ein breites Spektrum an solchen Metaphern vor dieser Versuchung. Ich, für meinen Teil, bin zunehmend von Wissenschaftlern und Philosophen beeindruckt, die nicht-mechanische Metaphern finden, mit denen sich die Gaia-Theorie darlegen läßt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Ellsabet Sahtouris' Analyse des wissenschaftlichen Prozesses gibt einen Trend wieder, der die Wissenschaft der nahen Zukunft möglicherweise ebenso unverständlich erscheinen läßt, wie unseren Vorfahren die heutige Wissenschaft hätte erscheinen müssen. So ist es richtig, uns daran zu erinnern, daß die Wissenschaft eine in permanenter Entwicklung begriffene menschliche Aktivität ist, ein lebendes System, in dem der Konservatismus von einer fruchtbaren Kontroverse ausbalanciert werden sollte. Nach all dem, was von Elisabet Sahtouris so trefflich beschrieben wird, sind alle gaianischen Systeme fortwährend damit beschäftigt, ihre Zusammenarbeit durch einen Interessenausgleich, ihre Einheit durch Vielfalt zu bestimmen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Die von diesem Buch ausgehende optimistische Betrachtungsweise, daß wir es trotz all unserer Irrtümer und trotz all unserer Unreife noch immer in der Hand haben, uns zu einer gesunden Spezies auf einem gesunden Planeten zu entwickeln, tut in Anbetracht der momentan grassierenden Weltuntergangsstimmung besonders not. Obwohl durch die anhaltende Zerstörung der Atmosphäre, der Wälder und anderer bedrohter gaianischer Systeme die Zeit knapp geworden ist, würde mich nichts glücklicher machen, als zu erleben, wie sich mit Hilfe der Gaia-Theorie eine bessere Welt für Gaia und ihre Menschen auf den Weg bringen läßt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
James E. Lovelock |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
1. Eine zweimal erzählte Geschichte |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Jeder weiß, daß die Menschheit in der Krise steckt – politisch, ökonomisch, geistig und ökologisch. Nicht wenige sehen die Menschheit auf dem Weg, sich mit den Hervorbringungen der eigenen Technologie selbst zu strangulieren. Viele andere meinen, uns treffe jetzt, als Vergeltung unserer Sünden, der gerechte Zorn Gottes oder der Natur. Von welchem Standpunkt wir es auch sehen mögen, die tiefsitzende Befürchtung, was unser zukünftiges Überleben angeht, bleibt bestehen. Woraus wir dennoch Hoffnung schöpfen können, ist die Tatsache, daß der Überlebenswille der stärkste menschliche Trieb ist, und daß wir mit der Suche nach Lösungen nicht inmitten einer Krise aufhören. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Wir sollten uns vielmehr, so lautet der Vorschlag dieses Buches, gemessen an der biologischen Evolution unseres Planeten, als eine noch neue, experimentelle Spezies betrachten, deren Entwicklungsstadien denen unserer individuellen Entwicklung entsprechen. Aus dieser Perspektive befindet sich die Menschheit momentan in der Pubertätskrise und steht deshalb an der Schwelle zum Erwachsenwerden – quasi kurz davor, die volle Bedeutung des Wortes Humanität zu realisieren. Wie ein Heranwachsender mit all seinen Nöten neigen wir dazu, uns von der einseitigen Ausrichtung auf die Krise selbst oder von unserer fiebrigen Suche nach bestimmten politischen, ökonomischen, wissenschaftlichen oder spirituellen Lösungen deprimieren zu lassen und uns dadurch den Blick auf das größere Bild, auf die wirklichen Auswege aus der Krise zu verstellen. Wenn wir statt dessen bescheiden Hilfe von der Natur suchen, die uns schließlich hervorgebracht hat, werden wir die biologischen Schlüssel finden, um unsere größten Probleme auf einmal zu lösen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Einige dieser Schlüssel tragen wir unser ganzes Leben hindurch in uns. Andere lassen sich in den verschiedenen Entwicklungsstufen und Stadien des Lebewesens ausmachen, zu dem wir gehören – unserer Erde. Haben wir diese Schlüssel erst einmal entdeckt, werden wir uns fragen, warum wir sie so lange haben, ignorieren können. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Der Hauptgrund, daß wir diese Lösungen übersehen haben, liegt darin, daß wir uns bislang nicht als in ein größeres Lebewesen integrierte Organismen verstanden haben, etwa in dem Sinn, wie wir unsere Zellen als einen zu uns gehörigen Teil betrachten. Unser seit Tausenden von Jahren existierendes und am stärksten in den letzten »wissenschaftlichen« Jahrhunderten entwickeltes intellektuelles Vermächtnis bestand darin, uns erstens als losgelöst von der restlichen Natur zu betrachten, uns zweitens vorzumachen, wir sähen diese Natur – gewissermaßen in einem Abstand zu uns selbst – objektiv und sie drittens als einen riesigen Mechanismus aufzufassen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Diese »objektive«, mechanistische Sicht nahm ihren Ausgang in der griechischen Antike, als sich die Philosophie in zwei Schulen spaltete – in eine, in der die gesamte Natur, den Menschen einbegriffen, als lebendig und selbstschöpferisch, immer Ordnung aus der Unordnung produzierend, betrachtet wurde. Und in eine andere, nach der die »reale« Welt nur verstandesmäßig und nicht durch direkte Erfahrung erfaßt werden konnte und als Gottes geometrische Schöpfung immerwährenden mechanischen Gesetzen unterlag, die auch hinter unserer Illusion von Unordnung perfekt funktionierten. Diese mechanistisch-religiöse Anschauung ersetzte die ältere naturphilosophische Sicht und begründete damit das bis zum heutigen Tag fortwirkende westliche Weltbild. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Auf diese Weise wurden Philosophen wie Pythagoras, Parmenides und Plato zu den Gründungsvätern unserer mechanistischen Weltanschauung. Von den Vertretern der Renaissance – allen voran Galilei und Descartes – wurde diese Weltanschauung in die seitdem die menschliche Erfahrung prägenden wissenschaftlichen und technologischen Begriffe übersetzt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Was wäre geschehen, wenn diese Dinge einen anderen Verlauf genommen hätten, wenn die »organischen« Philosophen wie Thales, Anaximander und Heraklit, die den gesamten Kosmos als lebendig ansahen, den Sieg in dieser antiken Streitfrage davongetragen hätten? Was wäre passiert, wenn Galilei bei seinen Experimenten mit Fernrohr und Mikroskop, statt mit dem Fernrohr den Himmel nach der Bestätigung für Aristarchs astronomische Theorien abzusuchen, das Mikroskop benutzt hätte, um den Beweis für Anaximanders Theorie der biologischen Evolution der Erde zu finden? In anderen Worten: Was wäre eingetreten, wenn die moderne Wissenschaft und unsere Auffassung von der menschlichen Gesellschaft, statt aus der mechanischen Physik, aus der organischen Biologie hervorgegangen wäre? |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Wir werden nie erfahren, wie anders die Ereignisse verlaufen wären, wenn diese Männer den anderen Weg eingeschlagen hätten – ob sich etwa dann die Physik unter dem Primat der Biologie entwickelt hätte? Da die uns so lange vertraute mechanische Weltanschauung uns jetzt den Weg auf eine organische Sicht freigibt, scheint es so, als seien wir dazu bestimmt, letztlich doch den biologischen Pfad zu betreten. Diese organische Sichtweise wäre jedoch, das muß der Fairneß halber festgestellt werden, ohne die aus unserer mechanistischen Ausrichtung resultierende Technologie nicht möglich. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Mit der gleichen Technologie, die uns erlaubt, in das Weltall, vorzustoßen, sind wir auch imstande, die reale Natur unseres eigenen Planeten zu erkunden, d. h. zu entdecken, daß er lebendig ist und unter den die Sonne umkreisenden Planeten der einzig lebende. Die mit dieser Entdeckung verbundenen Folgerungen sind enorm, und wir haben noch kaum damit begonnen, ihnen nachzugehen. Mit Erstaunen haben wir die ergriffenen Schilderungen der Astronauten registriert, daß die Erde aus der Weltraumperspektive einem Lebewesen gleicht, um dann etwas später selbst dem Bann der in den Fotos sichtbaren lebendigen Schönheit unseres Planeten zu erliegen. Es verstrich aber noch geraume Zeit, bis genügend wissenschaftliche Beweise vorlagen, die zeigten, daß die Erde ein lebender Planet ist und nicht bloß ein Himmelskörper, auf dessen Oberfläche Leben anzutreffen ist. Allerdings widersetzen sich noch viele Wissenschaftler diesem neuen Konzept, weil sie die weitreichenden Auswirkungen fürchten, die sämtliche Wissenschaftsdisziplinen und wahrscheinlich die ganze Gesellschaft betreffen werden. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Der Unterschied zwischen einem mit Leben »bedeckten« Himmelskörper und einem lebenden Planeten ist zunächst nicht leicht zu verstehen. Nehmen Sie zum Beispiel den Begriff der »Ökologie«, der erst in den letzten Jahrzehnten, in denen uns die Verschmutzung und Zerstörung der Umwelt als unserer Lebensgrundlage bewußt wurde, in unseren Sprachgebrauch, unser Bewußtsein und Verhalten eingegangen ist. Die Entwicklung eines ökologischen Bewußtseins und Verhaltens bedeutete einen großen, wichtigen Schritt im Verständnis unserer Beziehungen zur Umwelt und den anderen biologischen Arten. Doch selbst in unserer ernsten Sorge um die Umwelt fehlt noch immer die Erkenntnis, daß wir selbst nur ein Teil eines viel größeren Lebewesens sind. Es ist eine Sache, mit unserer Umwelt so umzugehen, daß diese »menschenverträglich« fortbestehen kann. Eine ganz andere Sache ist allerdings die tiefe Einsicht, daß unsere Umwelt – wie wir selbst – so etwas wie ein Körperteil des Erdorganismus ist. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Trotz der Tatsache, daß wir die Erde erst relativ kurz als ein Lebewesen auffassen, wissen wir bereits einiges über ihre »embryonale« Entwicklung und ihre Physiologie. Die Organisation der Erde in eine Vielfalt von Lebewesen, die sich zu unterschiedlichen Umweltmilieus zusammenfinden, gleicht mehr oder weniger dem Vorgang, bei dem sich befruchtete Eier zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Zellen und schließlich Organen differenzieren. Eine Ausnahme macht die Erde allerdings: Bei ihrem Reifungsprozeß bleibt ihre Hülle intakt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Schon die frühesten, aus einem Transformationsprozeß der Erdkruste hervorgegangenen biologischen Arten schufen sich eine eigene Umgebung, die dann ihrerseits das Schicksal dieser Arten weiterbestimmte. Nicht viel anders bringen auch die Zellen in der embryonalen Entwicklung des Menschen ihre eigene Umgebung hervor, um von dieser anschließend in ihrer Form und Funktion modifiziert zu werden. Auch von einigen physiologischen Aspekten der Erde haben wir bereits Kenntnis. Beispielsweise, daß sie ihre Temperatur – trotz zunehmender Erwärmung durch die Sonne – innerhalb eines lebensverträglichen Bereichs hält, genau wie es ihre warmblütigen Kreaturen auch tun. Und genauso wie sich unser Körper ständig erneuert und permanent die in Haut, Blut, Knochen und anderen Geweben herrschende chemische Balance reguliert, »rekonstruiert« sich auch die Erde kontinuierlich und stellt laufend das in der Atmosphäre, den Meeren und Böden herrschende chemische Gleichgewicht neu ein. Wie auch hinsichtlich unserer eigenen Physiologie wissen wir zwar einiges, aber längst nicht alles über die Regelkreise unseres Planeten. Je tiefer wir in diese Prozesse eindringen, desto deutlicher wird, daß wir dabei nicht die mechanische Natur dieses Raumschiffs Erde untersuchen, sondern die selbstschöpferische, selbsterhaltende Physiologie eines lebenden Planeten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Für die meisten von uns ist dieses neuartige, nach der Erdgöttin der frühen griechischen Mythologie benannte Konzept von einem lebendigen Planeten Erde noch immer eine eher poetische oder spirituelle Metapher als eine wissenschaftliche Realität. Der Name Gaia wurde jedoch nicht gewählt, um eine Assoziation mit einem weiblichen Wesen, etwa als Reinkarnation der »Großen Göttin« oder der »Mutter Natur«, zu suggerieren oder gar um eine neue Religion zu begründen (obwohl es uns kaum schwerfallen dürfte, unseren Planeten als das »Wesen« zu verehren, von dessen Existenz wir seit undenklichen Zeiten eine Ahnung in uns tragen). Hinter der Auswahl dieses Namens steht einfach die Absicht, der Vorstellung einer lebendigen Erde im Gegensatz zu einem lediglich mit Leben bedeckten Planeten Ausdruck zu verleihen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
In der Tat ist der Name »Gaia« oder »Gäa« viel älter als das Wort »Erde«. Im Verlauf der vom Griechisch der Antike über andere hin zu den modernen Sprachen erfolgenden Wortwanderung ging dieser Name aber verloren. Im Griechischen hat »Ge« bzw. »Gä« bis heute Bestand, etwa in den auch in unseren Wortschatz übergegangenen Begriffen, wie »Geologie«, »Geometrie« und »Geographie«. Entsprechend unserer sonstigen Praxis, die Planeten mit den lateinischen Namen griechischer Götter zu bezeichnen, müßte die Erde eigentlich »Gäa« oder »Gaia« heißen. Im Griechischen wie auch im Englischen und Deutschen steht das gleiche Wort sowohl für »Welt« als auch für »Boden«. Das englische Wort »earth« entstammt der antiken griechischen Bezeichnung für die Bearbeitung des Bodens, ergazein. Es taucht in abgewandelter Form im Namen der nordischen Erdgöttin Erda wieder auf (der freilich nur als Kunstname, von J. Grimm eingeführt, existiert; das mythologische Pendant ist »Freya«, aus dem dann das deutsche »Erde« und das englische »earth« hervorging. So gesehen, steht also auch hinter dem Wort »Erde« eine weibliche Gottheit). |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Ich hoffe, daß diese Abschweifung ihren Zweck erfüllt – nämlich allen, die sich an diesem Namen und seiner Verbindung mit einem wissenschaftlichen Konzept stoßen, die Bezeichnung Gaia verständlicher zu machen. Lassen Sie uns jetzt diesen Mythos betrachten – die Schöpfungsgeschichte der tanzenden Gaia. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Seinen Ausgangspunkt nimmt dieser Mythos in dem von den alten Griechen Chaos genannten, von Nebelschwaden durchzogenen schwarzen Nichts – ein Bild, das uns an die modernen Fotos der über das All verstreuten Galaxien erinnert. In der Überlieferung ist dies die tanzende Göttin Gaia, die in weiße Schleier gehüllt durch die Dunkelheit wirbelt. Als sie sichtbar wird und ihre Rotationen immer mehr in einen Tanz übergehen, formt sich ihr Körper zu Bergen und Tälern. Aus dem Schweiß, der ihr entströmt, bilden sich die Meere. Mit ihren umherschlagenden Armen wirbelt sie zu guter Letzt den von Winden gepeitschten Himmel, Ouranos, auf, den sie als Schutz und Gefährten um sich legt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Obgleich sie später Ouranos oder lateinisch Uranus in ihre Tiefen verbannt, weil dieser das Verdienst der Schöpfung für sich beansprucht, bringt diese fruchtbare Vereinigung von Erde und Himmel Wälder und Geschöpfe, wie die Titanen, hervor, deren weiterer Fortpflanzung sämtliche Götter und Göttinnen der griechischen Mythologie und schließlich auch die sterblichen Menschen entstammen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Von Anbeginn an – so sagt der Mythos, ganz der menschlichen Psychologie entsprechend – waren die Menschen versessen darauf zu erfahren, wie all dies zustande kam und was die Zukunft bringen würde. Um diese Neugierde zu befriedigen, ließ Gaia an Orten wie Delphi ihr Wissen und ihre Erfahrung aus Erdspalten entweichen, wo ihre Priesterinnen diese »Emanationen« dann den Wißbegierigen interpretierten. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Selbst noch Jahrtausende nach diesem Schöpfungsmythos gehört diese Neugier zu den bestimmenden menschlichen Eigenschaften. Wenn Sie so wollen, entströmt Gaias Weisheit noch immer ihrem Körper – zwar nicht gerade in Delphi, aber überall dort, wo sich wissenschaftliche Untersuchungen mit unserem lebendigen Planeten beschäftigen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Es existieren noch weitere Parallelen zwischen der neuen wissenschaftlichen Entstehungsgeschichte von Gaia und der antiken Sage. Wie wir jetzt wissen, wurde die Erde im Verlauf ihrer kosmischen Geschichte zu einem lebendigen, selbstkreativen Organismus mit Bergen und Tälern, die aus ihrer Kruste hervorgingen; mit Ozeanen, die aus ihrem Inneren gespeist wurden. Als diese Kruste immer stärker durch Bakterien belebt wurde, entstand ihre Atmosphäre. Die aufkommende geschlechtliche Vermehrung brachte schließlich die größeren Lebewesen hervor – Bäume, Tiere und Menschen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Mit dem allmählichen Zusammenfügen der wissenschaftlichen Details zur biologischen Existenz unseres Planeten erzählen wir im Grunde die Geschichte von Galas Tanz nach. In diesem Zusammenhang relativiert sich – verglichen zum Gesamtgeschehen – auch die Evolution unserer eigenen Spezies. Wenn wir erst einmal die wissenschaftliche Realität dieses Lebewesens Erde samt seiner Physiologie richtig begreifen, werden sich unsere Einstellung und unser Umgang mit unserem Planeten zwangsläufig tiefgreifend verändern und so die Wege aufdecken, wie wir unsere momentan als riesig und unlösbar erscheinenden Probleme lösen können. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Vom gaianischen Standpunkt aus sind wir Menschen ein Experlment – eine Spezies im Versuchsstadium, die mit sich selbst und den anderen Arten im Widerstreit liegt und die immer noch nicht gelernt hat, ihre eigene Dynamik auf die ihres Planeten abzustimmen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Arten sind die Aktivitäten der Menschen nicht biologisch programmiert – wir sind nichts anderes als ein Experiment des Prinzips der Verhaltensfreiheit. Das verleiht uns zwar ein enormes Potential, bereitet uns aber auch ein Wechselbad aus starkem Egoismus und großer Angst. Mit anderen Worten: Wir befinden uns in der Phase der Pubertät. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Die Geschichte des Menschen mag uns, wenn wir auf all das zurückblicken, was sich bereits in ihr zugetragen hat, als sehr lange vorkommen. Aber wirkliche Kenntnis haben wir nur von den wenigen letzten tausend Jahren, und als Menschen gibt es uns erst seit ein paar Millionen Jahren, wohingegen die gaianische Evolution schon Milliarden von Jahren währt. Als Spezies sind wir noch kaum den Kinderschuhen entwachsen und müssen uns schon – bedingt durch unseren rapiden sozialen Wandel – mit den Schwierigkeiten der Pubertät herumschlagen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Wie wir noch sehen werden, sind die Menschen nicht die ersten gaianischen Geschöpfe, die sich selbst und dem gesamten Gaia-System Probleme bereiten. Wir sind jedoch – falls uns die Wale und die Delphine in ihrer Entwicklungsgeschichte nicht darin zuvorgekommen sind – die ersten Geschöpfe Gaias, die Probleme verstehen, darüber nachdenken und diese auch in freier Wahl der Methoden lösen können. Unser Erwachsenwerden als Spezies – so die Argumentation dieses Buches – hängt davon ab, ob wir realisieren, daß unsere naturhaft ererbte Verhaltensfreiheit mit Verantwortung verbunden ist, indem wir unser Streben nach Eigenwohl mit dem Streben nach dem Wohl unseres Planeten verknüpfen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Unsere Fähigkeit zur Objektivität, uns selbst als das »Ich« (engl.: »l«) oder »Auge« (engl.: »eye«) des Kosmos zu betrachten, uns für von der Natur unabhängige Wesen zu halten, hat unsere Egos anschwellen lassen. Wir haben es geschafft, »ich« vom »es« zu trennen und zu glauben, daß »es« – die Welt »da draußen« –- zu unserer freien Verfügung stünde, und uns dabei einzureden, daß wir entweder Gottes bevorzugte Kinder oder die klügsten und mächtigsten aus der Evolution hervorgegangenen Geschöpfe seien. Diese egoistische Attitüde ist der wesentliche Grund für unsere Pubertätskrise. Infolgedessen wäre ein Verhalten, das von größerer Bescheidenheit gekennzeichnet ist und von der Bereitschaft, von unserem Planeten zu lernen, der entscheidende Schritt zum Erwachsenwerden der Spezies Mensch. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Die gewaltigen Probleme, denen wir uns jetzt gegenübersehen – die weltweite Ungleichheit, der Hunger, die nukleare Bedrohung und die möglicherweise irreversiblen Schäden an der Natur (von der wir so sehr abhängen wie das Leben einer jeden einzelnen Zelle vom Funktionieren unseres gesamten Körpers) – sind samt und sonders »hausgemacht«. Diese Probleme haben ein derartiges Ausmaß angenommen, daß viele glauben, wir wären niemals mehr imstande, sie zu lösen. Und dennoch stehen wir gerade in diesem Moment an der Schwelle zum Erwachsenwerden, in einer Position, die uns erkennen läßt, daß wir weder vollkommen noch allmächtig sind, daß wir aber viel von unserem Mutterplaneten lernen können, der genausowenig wie wir perfekt oder allmächtig ist, aber in der Überwindung zahlloser großer und kleiner Schwierigkeiten über eine Erfahrung von Jahrmilliarden verfügt. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Wirft man einen zweiten Blick auf die Evolution, so werden außer der menschlichen Gattung noch weitere »Problemkinder« sichtbar, aber auch viele, die sich durch die Ausbildung kooperativer Strukturen von dem auf ihnen lastenden Konkurrenzdruck befreiten. Die Entwicklung der Zellen, aus denen zum Beispiel der menschliche Körper besteht, begann damit, daß sich Bakterien untereinander auf die gleiche Weise ausbeuteten, wie dies auch für den menschlichen Imperialismus charakteristisch ist. Mit den gleichen Transport- und Kommunikations-Technologien, die von jenen Bakterien entwickelt wurden, die sich zu dem kooperativen Unternehmen »Zelle« zusammenfanden, das unsere Existenz erst ermöglichte, sind wir dabei, uns zu einem einzigen »Menschheitskörper« zu vereinigen und dadurch die gaianische Evolution um einen weiteren Schritt voranzubringen. Aus den vorhandenen Lektionen der Evolution sollten wir genug Hoffnung schöpfen können, daß auch dieser neue, weltweit in Entstehung begriffene Organismus »Menschheit« lernt, das Kooperations-Prinzip anstelle des Konkurrenz-Denkens zu übernehmen. Die dazu notwendigen Systeme sind bereits erfunden oder entwickelt. Es mangelt uns aber noch am dafür notwendigen Verständnis, der Motivation und dem Willen. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Vielleicht wird es überraschen, daß wir einiges über kooperative Politik und Ökonomie ausgerechnet von der Natur lernen können. Die Soziobiologie hat in den letzten zwei Jahrzehnten über das tierische Erbe des Menschen ein eher trostloses Bild entstehen lassen. In diesem Bild fungiert das evolutionäre Erbe des Menschen als Beweis dafür, daß wir außerstande seien, uns von den Übeln gegenseitiger Gebietsansprüche und Aggressionen zu kurieren und statt dessen weiterhin an der ökonomischen Gier und der politischen Kriegsführung festhalten würden. Die Absicht dieses Buchs ist es zu zeigen, daß die soziobiologische Perspektive irreführend ist – so irreführend wie die von den früheren Biologen vertretene einseitige Sicht, die gesamte natürliche Evolution sei nichts anderes als ein blutiges Geschäft, ein harter Konkurrenzkampf zwischen den Individuen, der als Vorlage unserer modernen Gesellschaftsformen diene. |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
Betrachtet man dagegen die Evolution der Erde aus der Sicht der Gaia-Theorie, so erkennt man ein kompliziert gesponnenes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten, in dem auf die Entwicklung einer Struktur die Entwicklung einer anderen folgt, die die bestehenden Interessenkonflikte harmonisiert. Die Erscheinungsformen der Evolution machen uns den kreativen Behauptungswillen des Lebens in all seiner Komplexität deutlich. Die Natur erweckt in der Tat eher das Bild einer alle Ressourcen nutzenden Mutter, die im Interesse des familiären Wohlergehens alle relevanten Alternativen ausschöpft, als das eines rational kalkulierenden Ingenieurs, der eine perfekte, nach unveränderlichen Gesetzen arbeitende Maschine entwirft. Wissenschaftler, denen es angesichts eines solchen Anthropomorphismus schaudert, sollten nicht vergessen, daß der Mechanomorphismus, also die mechanistische Betrachtungsweise der Natur, nichts anderes ist als ein Anthropomorphismus aus zweiter Hand, da mechanistische Ideologien schließlich menschlichen Ursprungs sind. Ist es nicht plausibler, daß die Natur mehr ihren eigenen Geschöpfen ähnelt als einem unlebendigen Produkt eines ihrer Geschöpfe? |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
(...) |
||
|
|
||||
|
Siehe auch |
|
Jim E. Lovelock: Unsere Erde wird überleben – Gaia – A new look at life on Earth (1979) |
||
|
|
|
James Lovelock: Das Gaia-Prinzip – Die Biographie unseres Planeten |
||
|
|
|
James Lovelock: Gaias Rache – Warum die Erde sich wehrt |
||